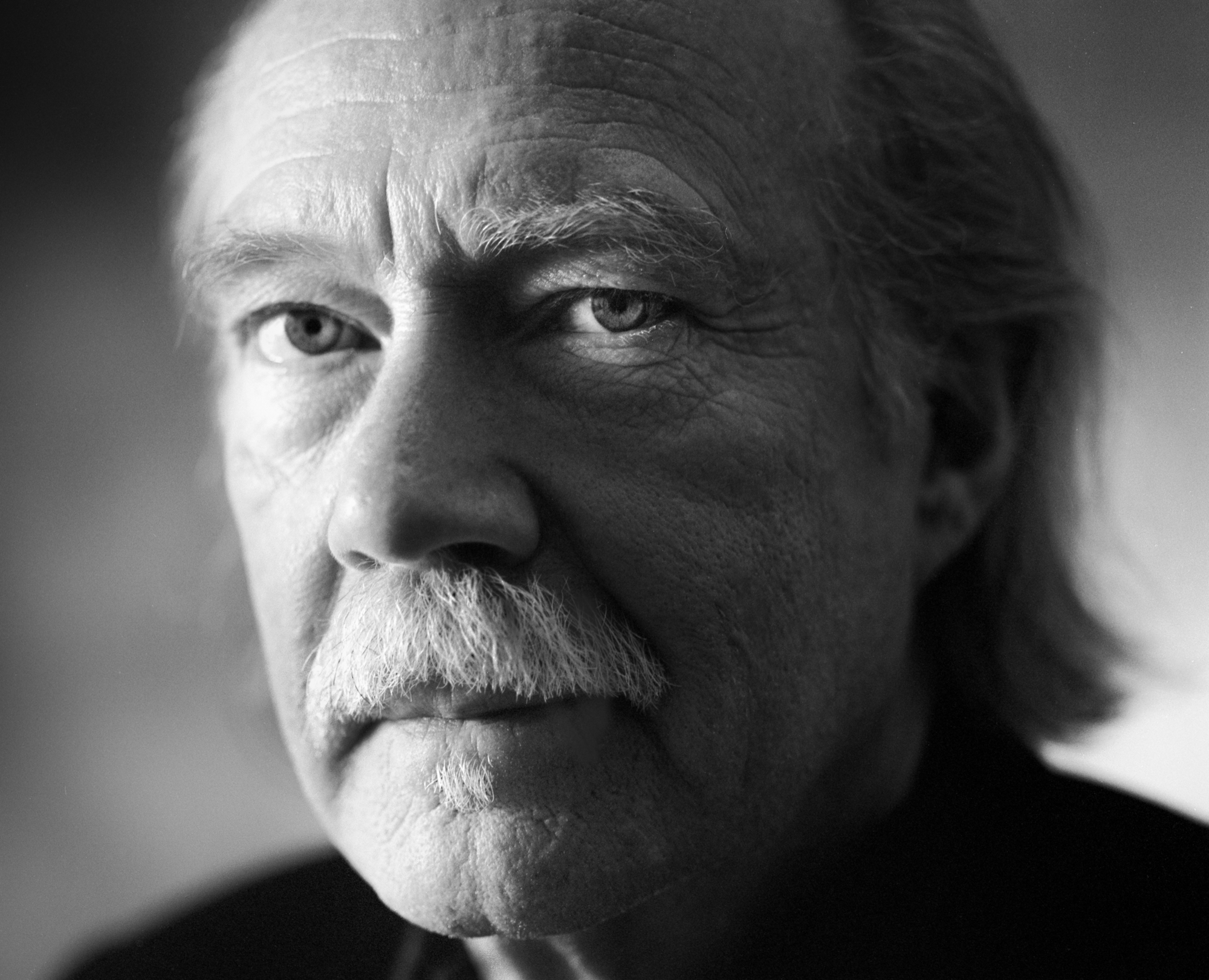Revolver Live! mit dem Kameramann Jürgen Jürges, im Rahmen der Diagonale Graz. Am 07.04.2024, 14 h. Mit Christoph Hochhäusler und Nicolas Wackerbarth.

Jakob Häußermann: Worum geht es in „Mister Universo“, eurem neuen* Film?
Tizza Covi (T): Vor circa fünfzehn Jahren haben wir bei der Recherche zu „Babooska“, der ja der erste Film von uns war, der im Zirkusmilieu spielt, Mister Universum kennengelernt. Er war der erste schwarze Mister Universum der Welt. 1956 ist er Mister Universum geworden und dann ist er zum Zirkus gegangen und hat Eisen gesprengt, Eisen verbogen und sie dann als Glücksbringer verschenkt. Der war schon ein totaler Superstar. In dem Film geht’s darum, dass ein zwanzigjähriger Bub, Tairo, so ein Eisen, das er mal geschenkt bekommen hat, verliert. Er möchte es gerne wiederhaben und begibt sich dafür auf die Suche nach diesem Mister Universum. Seine Suche, wie sie dann im Film zu sehen ist, ist im Grunde auch die Geschichte unserer Recherche für den Film. Wir haben anderthalb Jahre gebraucht, um ihn zu finden. Da findet man nichts im Internet. Da kannst du nur die Leute fragen. Kennt ihr den? Wisst ihr etwas von ihm? Es geht also um die Suche des Jungen nach diesem Mister Universum und ob er ihn findet oder nicht.
Rainer Frimmel (R): Und es geht natürlich auch um die Personen, die er auf der Suche trifft.
T: Der ganze Film spielt in Italien. Wir haben südlich von Rom angefangen und in Mailand haben wir aufgehört. Aberglauben spielt in Italien natürlich auch eine große Rolle. Einen Glücksbringer zu haben ist quasi selbstverständlich, jeder hat so seine Mittel, vom Kartenlesen bis Salz-Werfen, um das Unglück wieder abzuwenden. Das ist auch alles eingebaut. Und alle Figuren spielen sich selber. Mister Universum spielt sich auch selber. Es ist genau das gleiche Konzept, wie in unseren anderen Filmen. Im Grunde funktioniert das so bei uns: Wir haben Leute, die uns interessieren und für die schreiben wir ein Drehbuch. Das heißt, wir haben von Anfang an gewusst, wir wollen mit Tairo, dem Jungen, den wir schon von den Dreharbeiten zu „La Pivellina“ kannten, und mit Mister Universum arbeiten. Und dann schaut man, wie man die zusammen kriegt. Natürlich hat ihre Lebensgeschichte und das, was sie getan haben, ein große Relevanz. Darum das mit dem Eisenbiegen. Mister Universum hat uns erzählt, dass ihn immer noch Leute besuchen, die Eisen haben. Und die kommen und zeigen ihm das, oder wollen, dass er es unterschreibt, oder sie wollen ihm sagen, was es für sie bedeutet. Für uns ist das nicht so ein realistischer Gedanke einen Glücksbringer zu haben. Aber in Italien und vielen südlichen Ländern schon.
R: Aber wir haben auch…
T: Wir haben auch…
R: Glücksbringer.
T: Und auch schon seit 15 Jahren. Seitdem wir Filme machen eigentlich.
Julia Tielke: Ihr habt auch so ein Eisen?
T: Ja, wir haben ja Mister Universum noch gesehen als er aufgetreten ist. Der ist jetzt fast 90. Dabei sieht er aus wie 45 vielleicht. Der trainiert jeden Tag zwei Stunden, der ist so ein Schrank. Also wirklich, der schaut sehr jung aus. Wir haben ihn aber noch gesehen als er noch aufgetreten ist und da hat er uns auch solch’ ein gebogenes Eisen geschenkt. Er hat nie Filme gemacht, aber sehr viele große Angebote gekriegt, wie all diese Bodybuilder. Also Arnold Schwarzenegger kommt ganz zum Schluss von diesen Leuten. Aber die anderen haben auch Tarzan gespielt oder was auch immer, große Rollen. Ich weiß jetzt nicht mehr wie sie alle heißen. Steve? Das interessiert mich dann doch nicht so. Aber er hat auch immer diese Angebote gekriegt und abgelehnt. Das muss man sich schon einmal vorstellen, du bist 87 und kriegst jetzt nochmal so ein Angebot. Da kann man sich viel kaputt machen, wenn du die Leute nicht kennst, mit denen du arbeitest. Was unsere Filme ausmacht, die Qualität, ist diese Beziehung, die schon da ist. Das heißt, er weiß jetzt, nach dem er uns 15 Jahre kennt und sich die Filme angeschaut hat und wir ihn immer besucht haben, dass wir, wenn wir mit ihm arbeiten, einfach das Beste von ihm zeigen wollen. Du kannst ja Leute auch demontieren.. Aber er hat sich auch sehr gefreut. Wir wollten dann auch recht schnell drehen, weil man natürlich nie weiß mit älteren Leuten.
R: Und dann war es aber eine gute Erfahrung. Auch die Konfrontation mit Tairo. Am Schluss treffen sie aufeinander und da haben, glaube ich, beide sehr profitiert. Tairo hat vorher immer gedacht, was soll er bei dem Neunzigjährigen. Das interessierte ihn überhaupt nicht. Dann war es aber sehr nett. Es wird im Film ja auch so gezeigt, dass beide wirklich sehr voneinander lernen können. Tairo kannten wir schon von den Dreharbeiten zu „La Pivellina“, da war er dreizehn. Mittlerweile ist Tairo Italiens jüngster Löwendompteur und ist ja eben auch im Film Löwendompteur.
R: Schon bei „La Pivellina“ haben wir gemerkt, dass er sehr spontan, sehr originell, authentisch und ganz eigenwillig ist, sich für unsere Arbeit sehr eignet. Er ist sehr überraschend und auf eine Art auch tollpatschig. Es passieren ihm immer irgendwelche Dinge, die man nie vorhersehen kann. Das ist natürlich für unsere Arbeit sehr dankbar.
T: Im Grunde ist es auch das, was unsere Arbeit ausmacht. Wir schreiben zwar relativ präzise Drehbücher, wie es ausschauen soll, aber wir verwenden im Schnitt dann immer das, was uns überrascht hat, was nicht so gegangen ist, wie wir es wollten. Das ist eigentlich immer interessanter als das, was man sich ausgedacht hat. Das kann man sich viel öfter anschauen. Wenn man mit dem Tairo dreht, fällt da kein Satz so, wie wir uns den vorgestellt hätten. Wir versuchen ja auch diese klassische Dramaturgie zu zerstören. Zum Beispiel in „La Pivellina“: Eine Frau findet ein Kind, und, was macht sie jetzt? Aber die Dramaturgie ist nicht klassisch, weil es nicht aufgelöst wird, sie sucht nicht wirklich, sondern es geht dann mehr um den Alltag. Und so ist es in dem neuen Film auch wieder. Tairo sucht den Mister Universum, aber während der Suche besucht er seine ganze Familie, die in Italien verstreut ist und fragt die halt. Aber die Zerstörung einer klassischen Dramaturgie und von dem, was man erwartet, das ergibt sich automatisch, wenn man sich drauf einlässt, was wirklich passiert und nicht auf das beharrt, was man geschrieben hat.
Julia: Wiederholt ihr Szenen auch und erarbeitet sie mit den Darstellern oder geht ihr mit dem um, was passiert?
T: Inzwischen ist es so, dass die meisten Szenen, die wir verwenden, erste Klappen sind. Die haben etwas ganz Spezielles, das kannst du nicht mehr wiederholen. Gleichzeitig haben wir inzwischen gelernt, dass man, falls irgendetwas schief geht oder falls sie nicht in der Länge hält, eine Szene nochmal dreht, mit einem anderen Objektiv, so dass man schneiden kann. Ich habe im Schnitt schon viel geschimpft, was uns alles fehlt bei den anderen Filmen. Aber da haben wir sehr viel dazugelernt.
R: Aber es ist auch immer sehr unterschiedlich, abhängig von den Szenen. Es gibt auch bei uns eher dokumentarische Szenen, oder eher Spielfilmszenen, die wir mehr inszenieren, weil sie für die Geschichte wichtig sind, wo ein bestimmter Satz fallen muss, der für die Geschichte wichtig ist. Die versuchen wir dann schon zu inszenieren, an denen arbeiten wir dann ein bisschen, an denen wird schon gefeilt. Die dokumentarische Sachen aber kann man gar nicht wiederholen. Die passieren einfach und die werden dann einmal gedreht.
T: Gleichzeitig muss man sagen, wir arbeiten ja nur mit Naturlicht, wir arbeiten auf Super 16, und der Rainer schärft alleine, der macht ja die Kamera. Das heißt, du kannst nie davon ausgehen, dass du es schaffst, die Schärfe zu halten. Die Leute bewegen sich ja wie sie wollen. Und wenn man dann noch eine offene Blende hat… Also wir bestehen nicht darauf, dass in unseren Filmen alles scharf ist, wenn einer kurz aus dem Fokus geht ist das überhaupt kein Problem, aber wenn viel unscharf ist, können wir die Szene nicht verwenden. Und da wir meistens die Blende nur erhöhen können, in dem wir einen höher empfindlichen Film einlegen, ist es oft auch deswegen, dass wir die Sachen zweimal machen, aus technischen Gründen.
R: Da merke ich dann, das war jetzt vielleicht unscharf, das müssen wir nochmal machen. Es gibt immer verschiedene Gründe wieso man eine Szene zwei bis dreimal oder viermal macht. Aber so dokumentarische Sachen, die können wir nur einmal machen. Die müssen dann einfach passen. Und meistens passen sie eh. Also wenn wir dann zum Beispiel den Tairo in irgendeine Situation hineinversetzen, die nur jetzt passiert.
T: Zum Beispiel muss er den Löwenkäfig abbauen. Das heißt er baut ihn ab wie er ihn immer abbaut Man sagt ihm dann vielleicht etwas wie: Versuch’ dich zu erinnern, in welchem Moment du jetzt bist. Aber ansonsten ist es eine reine Dokumentation, wie er mit den Leuten redet, wie er abbaut.
R: Oder es geht eine Prozession an ihm vorbei und da wollten wir, dass er dort ist. Es muss einfach alles in diesem Moment passen.
T: Er schläft im Auto und da kommt anschließend eine Prozession an ihm vorbei.
R: Und so etwas kann man natürlich nur einmal machen.
T: Da kann man die Leute nicht wieder zurückholen und sagen, wir haben es nicht geschafft. Aber davon profitieren wir ja total, dass wir alles, was wir finden, einfach in unseren Film einbauen. Wir müssen nicht die Leute und die Prozession organisieren, das ist alles dokumentarisch. Wir wissen, die ist einmal im Monat, die startet um Mitternacht und geht bis 6 in der Früh, bis zu diesem heiligen Ort. Und dann, wenn wir dort parken, dann laufen die an unserem Auto vorbei.
Jakob: Das heißt euer Buch basiert auf langen Recherchen?
T: Ja, wir haben ganz viel Zeit mit Tairo und Mister Universum verbracht. Die Orte recherchiert, wo sie sein werden, was es dort für spezielle Sachen gibt.

Rainer Frimmel, Tizza Covi ©AFC
Julia: Es klingt so als würdet ihr mit eurer Arbeitsweise einen Raum für den Zufall öffnen?
R: Absolut. Zufall spielt eine ganz große Rolle in unseren Filmen. Also eigentlich leben wir auch davon, dass Dinge passieren, die wir quasi herausfordern. Wir fordern halt den Zufall heraus. Das ist irgendwie unser Konzept beim Drehen, dass man Zufälle oder Dinge herausfordert. Das ist quasi auch unsere Aufgabe, die Dinge herauszufordern. Und wenn man es nicht herausfordert, dann passieren sie auch nicht.
Julia: Ihr habt ja einerseits einen fiktionalen Rahmen, wofür ihr bestimmte inszenierte Szenen, die sich ganz klar von den dokumentarischen unterscheiden, nacheinander mithilfe eines Drehplans abdreht. Wie sieht das dann konkret aus, wenn etwas unvorhergesehenes passiert, entscheidet ihr euch dann, das was ihr gerade dreht zu unterbrechen oder wie kann man sich das vorstellen?
T: Genau, schon so. Und die Sache ist, wir haben sehr wenig Material in Wirklichkeit, weil wir auf Film drehen. Das heißt, man muss sehr sparen. Wenn wir das Buch schreiben haben wir jede Filmrolle theoretisch im Kopf. Wir drehen dann chronologisch, also wir fangen mit der ersten Szene an und drehen chronologisch weiter. Wenn etwas passiert mit dem wir nicht gerechnet haben, können wir das Drehbuch danach schon so verändern, das wir das mit einbeziehen. Was ist passiert und was ändert das an der ganzen Geschichte? Und das wäre nicht möglich, wenn man nicht chronologisch dreht. So können wir die Zufälle oder die Dinge, die passieren, aufnehmen und unser Konzept basierend auf diesen Dingen verändern. Das habe ich immer sehr klar im Kopf, weil ich ja auch den Schnitt mache. Und ich habe das wirklich gelernt, wie gut das ist, wenn man das schon einbezieht.
R: Wenn dann irgendwelche Figuren auftauchen, Personen, wo wir merken, die könnten jetzt wirklich eine größere Rolle im Film bekommen, dann bauen wir die halt auch so ein. Und dann nehmen wir von denen auch wieder Dinge ins Drehbuch hinein, von denen wir vorher überhaupt nicht gewusst haben, dass die auftauchen werden. So kriegt das dann eine eigene, andere Richtung. Das macht es dann auch spannend.
T: Das ist mehr was uns interessiert.
R: Das kann natürlich auch schief gehen.
T: Sicher, man zahlt im Schnitt immer die Rechnung für diese Dinge. Gleichzeitig bestehe ich ja darauf, dass ich die klassische Dramaturgie inzwischen furchtbar langweilig finde. Wenn immer alles eine logische Schlussfolgerung hat. Ich habe es total gerne, wenn gewisse Geschichten aufgemacht werden und nicht auserzählt werden oder keine logische Schlussfolgerung haben. Das Fragmentarische erhebt sich bei uns ja ein bisschen zum Stil. Das man sagt, ja, das haben wir jetzt angerissen und vergessen weiterzuerzählen. Ich sag nicht, dass das gut ist, aber dass uns das mehr interessiert, dass wir uns das in dem System, in dem wir arbeiten, einfach erlauben. Wir arbeiten zu zweit, und wir haben von keiner Seite Druck, einen gut funktionierenden Film zu machen. Das muss man auch bedenken. Dadurch machen wir das auch so, wie es uns vorkommt.
Julia: Produziert ihr eure Filme auch selber?
T: Wir produzieren selber, wir schreiben selber, wir drehen selber, wir machen die Postproduktion selber, den Schnitt selber. Wir machen alles selber. Ein Film von uns ist im Grunde wie ein Kunstwerk. Wir haben beide Fotografie studiert und erst als künstlerische Fotografen gearbeitet. Und in der Fotografie ist es einfacher, da brauchst du nur die Vergrößerung. Im Grunde ist so ein Film ein gemeinsames Kunstwerk. Da können wir alles machen, was bei einer klassischen Filmproduktion komplett aus dem Rahmen fallen würde.
Julia: Also gibt es keine Instanz, vor der ihr Euch rechtfertigen müsst?
R: Doch so eine Instanz gibt es schon, wir arbeiten ja auch mit öffentlichen Geldern. Wir kriegen das immer von der Kunstförderung und das ist explizit für künstlerischen Film, wo mit geringem Budget gearbeitet wird, dafür aber die Freiheit und Offenheit zum Experimentieren da ist. Wir haben keinen kommerziellen Druck, aber natürlich freut es uns dann auch, wenn der Film dann läuft oder gesehen wird. Und das war bis jetzt auch so ein Glück. Aber das ist nicht unser primäres Ziel. Also solche Filme zu machen, die nach gewissen Kriterien funktionieren, damit man Erwartungen von Leuten erfüllt, damit sie sich das anschauen. Das ist, glaube ich, beim Filmemachen ein großes Problem. Ich sehe es ja mittlerweile auch bei Dokumentarfilmen, da geht es auch schon immer darum, wie viel Zuschauer der Film haben wird. Die werden alle sehr spekulativ gemacht und dann geht es letztlich darum, wie viele Zuschauer im Kino sind. Ich glaube aber, dass das nicht primär die Aufgabe eines Dokumentarfilms ist. Natürlich soll er gesehen werden, aber nicht um die Kassen des Produzenten zu füllen.
Jakob: Also ist für Euch der dokumentarische Aspekt immer noch entscheidend, obwohl die Filme wie Spielfilme funktionieren?
R: Ich finde absolut. Für mich ist das Dokumentarische das Interessanteste. Wie gesagt, wir kommen beide von der Fotografie. Und auch Fotografie ist ein Sammeln von Zeit und von Vergangenheit und ein Festhalten von Momenten. Ich bin da vielleicht auch ein Nostalgiker, der gerne festhält, und deswegen interessiert es mich beim Film auch wirklich solche Welten wie den Zirkus und den Löwendompteur festzuhalten. Welten auch, die es bald in dieser Form sicher nicht mehr geben wird. Und wenn man dann die Möglichkeit hat da irgendwie hineinzukommen…Wir kommen ja auch immer über die Fotografie in diese Welten hinein. Das ist bei uns immer der erste Schritt. Wenn man dann so ein Vertrauen hat, dass man Filme machen kann, dann ist das sehr schön.
T: Die Spielfilmelemente sind ja auch dokumentarisch. Wenn jemand sich selber spielt und das tut in seinem Wohnwagen, oder in seinem Haus oder in seinem Theater, dann sind selbst diese Inszenierungen, selbst diese Spielfilm-Elemente in Wirklichkeit rein dokumentarisch. Im Grunde gibt es in unseren Filmen eben immer nur diese kleine Krücke, die wir einbauen, um das irgendwie anders als in reinen Dokumentarfilmen erzählen zu können.
R: Solche Szenen, wo die Patti das Wasser holt, wenn sie den Schlauch wieder abgesteckt hat. Um solche Szenen festzuhalten, mache ich Film. Dass da jemand lebt, der sich bei einem Hydranten das Wasser für seine Waschmaschine holen muss.
T: Wir haben eine Vorliebe für Alltäglichkeiten. Und das hat sonst sehr wenig Platz im Kino. Weil das Kino natürlich als Kompensation für das eigene langweilige Leben benutzt wird. Da muss man Superhelden haben, von denen man träumen kann. Deswegen kommen Alltäglichkeiten so selten vor. Uns interessiert es aber und wir können uns erlauben so etwas zu zeigen. Dann gibt es vielleicht wenig Publikum oder nur ein ganz spezielles. Aber das ist, was uns am meisten interessiert. Was das Leben auch am meisten ausmacht in Wirklichkeit. Es ist nicht so oft im Leben, dass einer erschossen wird, oder was explodiert oder was auch immer. In Wirklichkeit macht das Leben diese Alltäglichkeiten aus, bei denen wir halt gerne zuschauen.
Jakob: Wie genau nähert ihr euch diese Welten fotografisch?
R: Wir beginnen immer zu fotografieren. Das ist dann auch ein erstes Vertrauen finden. Dann zeigt man die Fotos, dann gewöhnen sich viele auch schon daran, dass sie im Visier sind, dass wir uns interessieren, aber quasi selber auch davon profitieren. Also wenn man fotografiert, nimmt man ja auch immer etwas von Leuten, aber wir zeigen ihnen die Fotos dann auch. Das ist schon ein sehr langes Vertrauen aufbauen. Das war gerade bei dieser Arbeit jetzt sehr wichtig, im Zirkusmilieu, weil das schon eine sehr eigene Welt ist, die sich nach außen hin, aufgrund von Ressentiments, die es da gibt, sehr gegen die Welt abschottet. Und dort bewegen wir uns jetzt wirklich seitdem wir da diese Fotos gemacht haben – das ist mittlerweile auch schon 20 Jahre her oder so. Das ist bei unserer Arbeit immer sehr wichtig, das ist ein ganz langer Vorprozess, der aber auch jetzt nie spekulativ ist, dass wir sagen, ja wir wollen jetzt unbedingt einen Film machen und schleichen uns da ein, sondern wenn es sich ergibt, wenn wir merken, das geht jetzt über das Interesse des Fotografierens hinaus, die Leute würden sich auch für einen Film anbieten, dann überlegen wir es uns einfach. Wir machen das alle zwei, drei Jahre, weil es eben so eine lange Vorarbeit ist. Das Schreiben geht dann relativ geschwind.
T: Ganz flott. Das Machen geht auch flott dann. Wir haben zum Beispiel für diesen Film keine Zusage gehabt, als wir gedreht haben, auch kein Geld gehabt. Das heißt wir haben eine nette Freundin, die uns das gesamte Geld geliehen hat, damit wir das drehen können. Wir haben dann Gott sei Dank die Zusage bekommen. Das sind aber auch so Dinge, da sichern wir uns nicht unbedingt ab. Da sind wir wahnsinnig genug, da denken wir das wird schon, das kriegen wir schon hin, das müssen wir jetzt machen.
Julia: Was bedeutet das, wenn ihr sagt, das Schreiben geht schnell? Ihr entscheidet euch, dass ihr mit diesen bestimmten Leuten gerne einen Film machen wollt und dann setzt ihr euch hin und schreibt?
T: Dann recherchieren wir. Wir haben das im Dezember entschieden, da kann ich mich dran erinnern. Wir waren im Dezember in Neapel beim Tairo und haben das entschieden. Ich war dann noch vier oder fünf Mal in Italien um die Leute zu besuchen und die Fotos zu machen. Dann hat der Zirkus gewechselt, dann musste ich die Leute dort kennenlernen und fragen, ob wir da drehen können. Geschrieben haben wir dann im September. Und gedreht haben wir im Oktober. Also das ist schnell.
R: In den Drehbüchern sind auch keine Dialoge drin.
T: Das sind hauptsächlich viele Fotos und Szenen, die beschreiben, wie die Geschichte von Anfang bis Ende abläuft.
Julia: Und während des Drehs passt ihr das Drehbuch dann kontinuierlich an, je nachdem was passiert?
R: Ja, das verändert sich dann schon ziemlich.
Jakob: Schreibt ihr das dann auch auf, oder adaptiert ihr das im Kopf?
T: Ich schreibe schon, welche Szenen wir haben und welche ich hätte haben sollen. Das sind Dinge, die interessieren den Rainer nicht wirklich, Drehbuch, oder?
R: Also naja, natürlich interessiert es mich, aber ich bin nicht so strukturiert.
T: Genau.
Julia: Also du bist dann eher diejenige, die den Überblick über die Geschichte hat?
T: Ja, sicher, ich schreibe das ja auch zusammen und ich mache den Schnitt. Das interessiert mich irrsinnig, dass da alles da ist, was ich brauche. Wenn der Rainer sagt, und er hat ja auch Recht, man kann aus allem eine Geschichte machen, dann würde ich schon sagen, diese Spielfilmelemente, dass das etwas ist, was mich sehr interessiert, während ihn hauptsächlich das Dokumentarische interessiert.
R: Sie macht sich auch immer Notizen, was die Leute angehabt haben. Das ist total wichtig für den Anschluss im Schnitt, dass sie dasselbe anhaben.
T: Und auch Nagellack, Lippenstift…
R: Mit Laien zu arbeiten ist dafür manchmal sehr schwierig, weil es schon passieren kann, dass jemand nicht dran denkt und zum Friseur geht und dann kann man nicht mehr weiterdrehen. Das sind so Kleinigkeiten auf die man total achten muss, weil sie wahnsinnig wichtig sind und große Probleme bringen können. Zum Beispiel hat Tairo im Film immer eine Jacke an, und am Schluss, als wir extra nochmal runtergefahren sind nach Rom, für die Schlussszene, wo er logischerweise diese Jacke anhaben muss, kommen wir drauf, dass sein Vater die Jacke in die Ukraine mitgenommen hat. Da mussten wir wirklich diese Jacke wieder auftreiben.
T: Da sind wir, ich weiß nicht in wie vielen Supermärkten gewesen. Wir haben drei Drehtage gehabt und ein Drehtag ist draufgegangen, um Jacken zu suchen. Die habe ich dann zusammengenäht, und ich kann überhaupt nicht nähen, damit wir eine Jacke haben, die so ausschaut wie das Original. Wir haben die Fotos mitgehabt, dass wir diese dumme Jacke…ein Horror war das. Das sind so Dinge, das sind echte Lernprozesse. Da bin ich jetzt ganz streng, mit den Haaren und schaue auch, dass ich die Kleider teilweise zu mir in den Wohnwagen oder ins Auto mitnehme, damit die ja nicht abhanden kommen.
Jakob: Das würdet ihr auch im Vorhinein kommunizieren? Habt ihr mit Tairo darüber gesprochen?
T: Sicher. 10000 Mal habe ich ihm gesagt, pass auf die Jacke auf. Wir können keine Szene ohne die Jacke machen.
R: Und schon als wir angekommen sind haben wir gemerkt, irgendetwas ist los, weil beim Tairo merkt man das immer, wenn etwas los ist. Er hat sich so komisch verhalten, bis er dann damit rausgerückt ist, plötzlich.
T: Er ist nicht damit rausgerückt. Ich habe gesagt, Tairo, heute um fünf Uhr drehen wir und dann bist du dort und dort, um 5 bist du dort mit deiner Jacke und deiner schwarzen Hose. Und um fünf Uhr kommt er und er hat eine ähnliche Jacke angehabt und sagt, wieso, war es nicht die? Und das ist blöd, wenn du nur so wenig Zeit hast, da war der ganze Tag weg. Und dann musst du noch die Jacke suchen und zusammennähen.
R: Aber er hat auch gewusst, zum Friseur darf er nicht gehen und das hat er brav eingehalten.
Jakob: Kannte er den Ablauf und den Inhalt der Geschichte?
R: Schon. Er hat gewusst, worum es geht.
T: Fakt ist, es interessiert unsere Darsteller eigentlich überhaupt nicht. Es fragt eigentlich niemand. Auch dem Mister Universum haben wir das einmal erzählt. Er hat dann gefragt, wie das ungefähr ist, aber es interessiert sie eigentlich nicht. Auch Tairo interessiert es nicht. Wir müssen uns auch danach richten, wann sie Zeit haben. Wenn wir kommen, dann müssen wir uns danach richten, wann der Tairo Zeit hat. Also einen Tag hat er keine Zeit und muss irgendwelche Papiere für seinen Lastwagen holen. Und an einem Tag ist der Löwe krank. Wir müssen wir uns danach richten, wann die Zeit haben. Wir können nicht sagen, wann wir am liebsten drehen würden wegen dem Licht, weil dann zum Beispiel kein Gegenlicht ist. Und dann ist es auch immer noch so – und uns kommt das sehr entgegen – dass uns in Wirklichkeit niemand ernst nimmt. Wir sind nur zu zweit, wohnen wir da auch in so einem trashigen Wohnwagen, sind immer freundlich und sagen: Okay, wenn du jetzt keine Zeit hast, dann komm in zwei Stunden, dann machen wir es halt dann. Das hat viele Nachteile, weil wir nicht so arbeiten können wie wir wollen. Das hat aber auch viele Vorteile, weil es dadurch alles ganz unspektakulär bleibt.
Julia: Das trägt bestimmt auch dazu bei, dass die Leute so ungezwungen vor der Kamera sind.
T: Ganz bestimmt.
R: Ja, das hilft sicher. Die Kamera, die ich habe, das ist zwar eine Super 16 Kamera, aber die habe ich halt auf der Schulter, das ist nicht so imposant. Deswegen wollten wir das auch wirklich nur zu zweit machen. Man dreht auch in einem Ambiente wo sehr wenig Platz ist, da ist dann einer fast schon zu viel, in diesen Wohnwägen. Andererseits, wenn du mehr Leute hast, die das Stativ tragen und Lampen aufstellen, desto wichtiger wirkt es dann.
Aber ich glaube unsere Filme und wir profitieren davon das wirklich im ganz Kleinen zu machen. Und davon, den Leuten nicht das Gefühl zu geben, dass das jetzt was ganz Besonderes ist, was wir da jetzt machen. Es ist auch wichtig, dass sie nicht zu große Erwartungshaltungen haben und glauben, sie sind jetzt die Superstars und werden nach dem Film berühmt.
Julia: Wenn sie beim Drehen an der Handlung des Films gar nicht so interessiert sind, ist dann eine totale Überraschung, wenn sie den Film dann sehen?
T: Total. Also die haben keine Ahnung wie das wird. Und, was ich noch hinzufügen muss, wenn wir arbeiten, wird auch niemand vorbereitet, was wir am nächsten Tag machen werden. Meistens sage ich, um vier brauchen wir den und den, die Wendy oder den Tairo, oder wen auch immer, und dann sagen wir kurz davor, was wir drehen werden. Also es ist nicht so, dass sie Zeit hätten einen Text vorzubereiten, was sie sagen sollen und in welcher Situation sie sind. Das finden wir auch immer am Schönsten. Wir drehen jetzt da und ungefähr so ist die Situation und dann legen wir los. Deswegen die erste Klappe.
R: Das ist schon auch unterschiedlich. Einfach charakterlich unterschiedlich, weil die Wendy, die zweite Hauptdarstellerin im Film, die die Freundin vom Tairo spielt, war schon interessiert. Sie hat auch viel von sich eingebracht in den Film. Ich würde nicht sagen, dass es komplett egal ist, sie war interessiert.
R: Die hat auch letztlich eine größere Rolle bekommen als geplant, weil von ihr auch sehr viel gekommen ist, sie wollte einfach gerne drehen.
T: Ich habe aber auch ganz viele Szenen mit ihr erarbeitet. Ich geh’ am Abend zu Wendy und sage, wie können wir das lösen? Was würdest du in dem Fall tun? Und dann höre ich mir das an, wie sie zur Zigeunerin geht und was die Zigeunerin ihr voraussagt und wie man es macht, wenn man das schlechte Auge hat, was man dann machen muss, damit man das Unglück los wird. Aber das ist ja nicht das Ziel, dass sie zu mir kommt, sondern ich sage wir sind in diesem Moment im Film, wie würdest du jetzt handeln? Das tun wir ja bei allem, dass wir sagen, was würdest du tun?
R: Ja. Aber das Engagement ist sehr unterschiedlich. Dem Tairo war eh alles wurscht.
Julia: Aber trotzdem hat er ein großes Vertrauen in euch, dass er da mitmacht, das ist doch schon sehr viel. Also warum macht er es dann?
R: Der Tairo? Es gibt viele Gründe.
T: Aber es ist auch definitiv so, dass wir mittlerweile unsere Darsteller sehr gut bezahlen. Also es ist nicht so, dass er nichts bekommt. Er oder Wendy, in Relation zu den Kosten, die wir haben, sind das eigentlich unsere größten Ausgaben. Die Gagen für die Darsteller. Also mehr als Material und Entwicklung, doch.
R: Das steht denen ja auch zu. Gerade auch dem Tairo.
T: Die Budgets sind immer gleich. Gleichzeitig arbeiten wir mit Leuten, die einfach dringend Geld brauchen. Außer bei „Glanz des Tages“ haben wir mit Phillip Hochmeier gearbeitet, und der hat gratis für uns gearbeitet. Weil, wenn der jetzt ein Budget verlangt hätte, das ihm entspricht, seiner Arbeit, dann wäre das für uns nicht möglich gewesen. Und die Leute wie der moldawische Tischler haben dafür ein bisschen mehr gekriegt, weil der Phillip drauf verzichtet hat. Wenn du mit Leuten drehst, wo du weißt, die brauchen einfach jeden Groschen, dann versuchst du denen auch so viel wie möglich zu geben. Was die privat hergeben, die Ausstattung, die Kostüme, die Geschichten, die Lebensgeschichten, das ist alles von ihnen, das ist einfach unbezahlbar. Und wir möchten, dass sie wissen, dass wir das nicht nur honorieren, weil wir sie mögen – das ist ja immer die Grundvoraussetzung, dass du mit Menschen arbeitest, die du magst – sondern weil sie auch wirklich viel von sich hergeben.
Julia: Und bei „La Pivellina“ ist die Geschichte, dass Patti das kleine Mädchen findet und mit nach Hause nimmt. Der Rest ist einfach der Zirkusalltag von Patti und Walter?
T: Genau. Bei „La Pivellina“ war es so, als wir denen die Geschichte erzählt haben, die wir uns da ausgedacht haben, waren sie am Anfang ganz ängstlich, weil sie gesagt haben: „Wir leben so, wir sind so, wir sind die Gleichen und wenn die Leute das sehen glauben sie, wir haben wirklich ein Kind aufgenommen ohne Bescheid zu sagen“. Und das waren die Zeiten, als in der ganzen Stadt Rassismus herrschte und Wohnwagen angezündet wurden. Das war so nah an ihrem realen Leben, dass sie am Anfang Angst hatten das zu machen, weil man denken könnte, dass das eine Doku ist und dann könnten sie Probleme kriegen in dem Viertel, in dem sie wohnen. Und das haben wir Gott sei Dank relativieren können und es war auch kein Problem. Aber das muss man auch bedenken. Das ist so nah am wirklichen Leben, wie kann man unterscheiden, was Fiktion und was dokumentarisch ist? Wir wird das von außen gesehen? Fakt ist natürlich, und das habe ich auch dem Walter gesagt, in dem Viertel wird niemand „La Pivellina“ sehen.
Julia: Wie haben sie dann darauf reagiert, als sie den Film gesehen haben?
T: Der Walter hat gesagt, er versteht nicht, was da besonders ist, weil das genau sein Leben ist, so ist es, und das ist eigentlich langweilig.
R: Das war die erste Reaktion. Und dann haben sie es öfter gesehen und dann hat der Walter eben noch andere Seiten im Film gesehen. Das hat ihm schon sehr viel für sich gebracht, der Film. Auch für Patti war das schon auch ein ganz besonderer Moment in ihrem Leben, das kann man schon sagen.
T: Die Patti hat auch einige Schauspielerpreise gewonnen, was ihr gut getan hat und was teilweise finanziell wirklich Spitze für sie war.
R: Sie ist auch rumgekommen.
T: Genau. Nach Spanien und wo auch immer hin. Das hat ihr urgut gefallen. Die Patti und der Walter sind wirklich Menschen, die sonst am Existenzminimum leben.
R: Der Walter hat in Locarno, den Leoparden für den besten Schauspieler bekommen. Das sind natürlich Sachen, die bleiben dein Leben lang. Das verbindest du dann immer wieder mit dem Film. Da haben wir denen auch schon was zurückgeben können, in dieser Form.
Julia: War das ein Unterschied mit Walter zu arbeiten, nachdem er diese Erfahrung mit „La Pivellina“ schon hatte und sich da auch selber gesehen hat im Film? Hat sich das ausgewirkt auf die Zusammenarbeit in dem zweiten Film? Oder war er da wieder genauso unbefangen?
T: Genauso unbefangen würde ich sagen.
R: Ja, mit dem Walter kann man wirklich sehr gut arbeiten. Also wenn’s um ihn geht, wenn es um etwas geht, was ihn betrifft oder sein Leben. Aber natürlich ist es ein bisschen anders, wenn schon Erwartungen da sind. Vor „La Pivellina“ haben die keinerlei Vorstellung gehabt, was in einem Film passiert. Dann war halt Cannes, da haben sie gemerkt, da ist man plötzlich auf der großen Leinwand. In Cannes war es köstlich, da sind sie angesprochen worden und die Leute haben Fotos mit ihnen gemacht.
T: Das war süß.
R: Und mit „Glanz des Tages“ waren dann natürlich auch die Erwartungen von Walter größer. Andererseits als er von dem Preis erfahren hat, da war er grad in Sizilien und hat in einem Zirkus gearbeitet und da habe ihm gesagt, er hat den Preis gekriegt und er soll jetzt rauf kommen zur Preisverleihung, da hat er gesagt, er ist jetzt hier unten, da hat er keine Lust jetzt extra da rauf zu fahren. Da haben wir gesagt, das ist sicherlich ein Ereignis, das vergisst du nicht so schnell, das ist auf der Piazza Grande, vor 8000 Leuten, da wird der Preis übergeben. Dann ist er schon noch rauf gekommen. Und das ist im Nachhinein eine total schöne Erinnerung für ihn. Also die Erwartungshaltung, die hat sich dann schon verändert. Die ist auch für Tairo jetzt größer geworden. Also unter Cannes ist für den Tairo nichts.
Jakob: Hat sich auch für Euch Eure Arbeitsweise zwischen „La Pivellina“ und „Glanz des Tages“ verändert?
T: „Glanz des Tages“ hat uns in der Arbeit ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, weil wir von Phillip nur die Wohnung in Hamburg verwenden konnten und nicht die in Wien. Die Wohnung vom moldawischen Tischler konnten wir auch nicht verwenden. Das heißt, dass wir die Leute das erste Mal in Wohnungen gesetzt haben, die nicht ihre sind. Diese Szenen sind auch die schwierigsten gewesen. Alles was wir in Hamburg gemacht haben, in Wohnungen, in Bars oder in Wien auf dem Pferderennplatz, das funktioniert super. Aber sobald wir uns ein bisschen um Ausstattung kümmern müssen – das haben wir dann in den eigenen vier Wänden gedreht, weil wir kein Budget dafür hatten – ist das für uns schon so, dass wir nicht mehr so zaubern können irgendwie. Wir spüren einfach, dass da was nicht stimmt. Aber das war auch ein guter Lernvorgang, dass wir gesehen haben, okay, das sind unsere Grenzen. Es funktioniert, wenn alles genauso ist wie es ist, also die Leute leben in ihren Wohnungen und in ihrem Umfeld und es ist alles original, aber wenn du ein bisschen schummelst, da reißt du dir schon die Hachsen aus. So haben wir das empfunden.
R: Jeder Film hat seine eigenen Gesetze. Natürlich lernen wir auch von jedem Film zum nächsten, aber im Grunde ist jeder Film wie wenn wir unseren ersten Film machen. Auch dass alles wieder hinhaut mit der Technik, mit der Kamera, mit dem Film. Wir sind erfahrener jetzt in der Arbeit als in „La Pivellina“ aber trotzdem ist man jedes Mal mit neuen Problemen konfrontiert, so dass man das Gefühl hat, man macht das zum ersten Mal.
T: Das kommt natürlich auch daher, dass man das nur alle drei Jahre macht, da ist wirklich viel Zeit dazwischen.
R: Aber wir lernen schon, dass wir zum Beispiel Szenen für den Schnitt nochmal wiederholen, mehr an den Schnitt denken und so. Das ha sich sicherlich viel verändert, weil wir sicherlich schon beim Drehen mehr an die Postproduktion denken als wir das davor gemacht haben. Auch mit dem Ton. Das ist ja eine eigene Wissenschaft für sich. Da haben wir sicherlich auch jetzt dazugelernt. Das ist natürlich wichtig in solchen Situationen einen guten Ton zu kriegen. Das haben wir auch mit jedem Film verbessert.
Julia: Könntet ihr Euch vorstellen auch wieder rein dokumentarisch zu arbeiten, wie ihr das am Anfang bei „Das ist alles“ und „Babooska“ gemacht habt? Oder habt ihr eure Form jetzt gefunden?
T: Also ich kann mir schon vorstellen rein dokumentarisch zu arbeiten, aber wenn ich die Möglichkeit habe, interessiert es mich mehr, diese Form weiterzuführen. Es ist eine größere Herausforderung als rein dokumentarisch, auch weil ich so gerne Geschichten erzähle. Das ist im Dokumentarfilm oft nicht so möglich. Für mich jetzt.
R: Ich kann mir das schon vorstellen.
Julia: Kannst du das noch genauer benennen, was das Spannende daran ist für dich?
T: Ja, dass du die Leute quasi in eine fiktive Situation stellst. Also in „La Pivellina“ ist die Situation, dass sie das Kind gefunden hat, fiktiv. Aber was sich dann ergibt, wenn wir sagen, jetzt musst du mit dem Tairo Windeln kaufen gehen. Was ergibt sich dadurch, dass man Leute in Situationen stellt, in denen sie eigentlich nicht wären. Das ist ja auch irgendwie dokumentarisch, aber das ist das, was für mich das Spannende ausmacht. Und diese Verknüpfungen, die man sich nicht vorstellen kann. Zum Beispiel war da ein Mann, der lebt am Fluss in einem Haus. Da haben wir zu Patti gesagt: Du hast in der Zeitung gelesen, dass sich jemand von der Brücke gestürzt hat und du gehst zu dem Mann und fragst den. Das heißt sie geht da runter, rein dokumentarisch, und fragt den: „Haben sie zufällig diese Frau gesehen?“ und „Hat sich jemand von der Brücke gestürzt?“. Und er sagt, nein, die Frau hat er nicht gesehen, aber gestern ist ein Mann, ein Ausländer, vorbeigekommen, der hat seine kleine Tochter gesucht und nicht gefunden. Das sind Dinge, die interessieren mich. Ich bekomme so durch Zufall eine Information über ein verschwundenes Kind und das schreib’ ich in mein Drehbuch rein. Und das ist das Mystische und das ist jetzt bei „Mister Universo“ extrem gut gelaufen, dass wir so Dinge für unser Drehbuch bekommen haben, die es bereichern und in einer gewissen Art und Weise weiterführen, obwohl die Leute nicht gewusst haben, worum es geht. Das ist etwas, was mich extrem fasziniert, mehr als nur das rein Dokumentarische, wie sich die Dinge in dein Drehbuch einreihen und die Geschichte wieder verändern. Es passieren auch so komische Dinge. Die Wendy schmeißt zum Beispiel für den Film eine Kerze in den Fluss, um das böse Auge loszuwerden. Da wirft man nun diese Kerze in den Fluss, in den reißenden Fluss, der Fluss bringt die Kerze weg und dadurch bringst du das Unglück weg. Und die Kerze schwimmt hinunter und dann schwimmt sie rückwärts wieder rauf. Ist doch ein Ding! In die Gegenrichtung. Und das ist so super. Weil, das kannst du dir nicht ausmalen, das kannst du ja noch nicht mal machen, da bräuchtest du den riesigen Hollywood…. Und das ist dann faszinierend, das sind Dinge, die mich total begeistern. Und im Schnitt ist das wie ein Puzzle zusammenstellen, das ist super. Und das habe ich im Dokumentarfilm nicht so. Meine eigene Geschichte ist ein bisschen wie ein Lausbubenstreich den du da hineintust und dann greift alles wie ein Werk ineinander.
Jakob: Diese Szene in „La Pivellina“, wo sie hinunter zu diesem Bauern geht, wie lief die genau?
T: Genau, der Bauer weiß von nichts.
R: Der glaubt das auch nicht.
T: Er sagt auch noch, er weiß gar nicht, ob er das erzählen kann und schaut so ein bisschen in die Kamera, weil er Angst hat, dass da ein Kind verschwunden ist und der Mann, der gestern den ganzen Tag sein Kind gesucht hat. Oder zum Beispiel in „La Pivellina“: Ich schreibe im Drehbuch, die Kleine sei ein bisschen verzweifelt und sage immer, sie will zurück zur Mama. Und was macht sie in Wirklichkeit? Immer wenn die Patti sagt, „Vermisst du deine Mama?“, sagt sie, nein, sie will nicht zurück zur Mama. Und jetzt ist die Frage, was machst du mit einem zweijährigen Kind? Bringst du dem bei, es muss sagen, „ja, ich will zur Mama“, oder nimmst du das als Anlass und dann kannst du wieder ganz viel weiterspinnen. Also, vielleicht ist die Mama drogensüchtig oder depressiv und es ist nicht so gut gegangen. Diese Dinge sind total faszinierend, wenn man so eine Hachse gestellt kriegt von der Wirklichkeit, die deine eigenen Ideen immer zu einem absoluten Humbug degradieren.
Julia: Das zwingt einen ja auch, so stelle ich es mir vor, sehr genau hinzugucken.
T: Ganz genau. Und man ärgert sich so. In „La Pivellina“ habe ich zu der Mutter des Mädchens gesagt: „Du setzt jetzt das Kind am Spielplatz aus, zieh sie an, wie wenn du sie aussetzen würdest.“ Und ich stell sie mir vor, wie ein russisches Kind mit Häkeljacke – o armes Kind – und da kommt die mit rosaroten Hosen und rosaroter Glitzerjacke und ich habe mir gedacht, nein, das ist überhaupt nicht, was ich mir vorgestellt habe. Wir haben es dann doch so gedreht und im Schnitt kommst du drauf, das ist genau richtig so, völlig glitzerrosa, so macht man das einfach. Da finde ich muss man schon über seinen Schatten springen. Es ist nicht immer so einfach, aber mittlerweile haben wir es gelernt. Du hast dieses ästhetische Ding und du willst dann einfach nicht dieses grausige Glitzerrosa. Aber dass man das dann doch macht, ist das, was wir mit der Zeit lernen. Alles hat oder kriegt seine Relevanz. Oder du kannst dem entgehen, indem du es in so eine fiktive Geschichte einbaust.
Julia: Und da greift ihr wirklich nie ein? Pattis knallrote Haare waren auch schon genau so da?
R: Die hat sie gehabt und die waren…
T: Die sind nie zur Diskussion gestanden.
R: Die sind ihr ja wirklich einmal passiert, weil sie zum falsche Haarfärbemittel gegriffen hat, aber dann hat es ihr so gut gefallen, dass sie die Haare immer so behalten hat. Dem Walter haben wir gesagt er darf nicht zum Friseur gehen, er muss seine Haare so lang lassen.
T: Beim neuen Film, als wir recherchieren gegangen sind, war der Tairo ein bisschen picklig, und er hat immer gesagt, ich würde gerne cooler aussehen. Er ist auch ein zwanzigjähriger Bub und will cool sein. Und wir haben gesagt, schau Tairo, du hast ein halbes Jahr Zeit, versuch 5 kg abzunehmen, uns ist es wurscht. Aber dann schaust du halt richtig cool aus. Und was war? Als wir zum Drehen gekommen sind, da hat er 10kg zugenommen. Und das sind auch so Dinge. Du hast so deine Vorstellung – der ist so cool und so lässig – derweil ist er ein totales Pummel und schaut total blöd aus, als Löwendompteur, weil er ausschaut wie Löwenfutter. Und gleichzeitig ist das für den Film super, dass du einen Löwendompteur hast, der nicht so ausschaut wie einer. Der daran scheitert an diesem zirkusschönen Körper. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch immer geschaut, dass wir ihn gut in Szene setzen. Also dass er gut ausschaut, wenn ihm das wichtig ist. Und wir haben ihn auch relativ schlank hinbekommen. Aber nicht wegen uns, uns hätte das auch so gefallen. Wir möchten wirklich, dass sich die Darsteller auch selber gefallen. Für mich ist es schon wichtig, das sagt ja auch der Roland Klick, und das find ich so schön, wenn du in einem Milieu arbeitest und aus dem Milieu Sachen kriegst, dann musst du denen etwas dafür zurückgeben. Und das ist bei uns eine ganz klare Ansage, dass wir das auch versuchen. Dass du etwas von denen nimmst und kriegst, aber dafür gibst du denen eine Ehre zurück oder einen Stolz, dass die Leute hinschauen und sich plötzlich in einem anderen Licht sehen. Das heißt, alles was wir eingreifen wollen geht meistens schief. Das haben wir auch schon erlebt.
Julia: Ja, das rosa Kostüm von dem Mädchen in „La Pivellina“ ist der Wahnsinn. Und auch die roten Haare von Patti. Sowieso die Farben, das Rot und Grün und Blau, das auch immer wieder auftaucht.
T: Das haben wir jetzt im Film wieder. Die Verlobte vom Tairo ist ein rothaariges Mädchen, was in Italien höchst ungewöhnlich ist. Und die Erde ist rot und der rötliche Hund und die Löwen sind rot. Das ist alles dieser Farbton, und das ist so cool, dass sich das so ergibt, obwohl du es nicht darauf anlegst.
R: Man nimmt die Farben dann auch ganz anders wahr.
T: Und auf Film schaut das so super aus. Dass das Digitale an den Film rankommt, das stimmt nicht. Ich lass mir von niemanden nehmen. Wir haben zwar manchmal Korn, manchmal großes Korn, aber diese Farben und was das transportiert, das pure Material, das ist einfach fantastisch. Also ich bin wieder total vom Material begeistert. Vom filmischen Material. Wir haben für diesen Film das gesamte Fujimaterial aufgekauft. Restmaterial. Das war schon abgelaufen für 2 Jahre. Am Anfang hatten wir bisschen Sorge, weil sie im Labor in Rom gesagt haben, dass es einen Schleier hat. Und das hat uns total leidgetan, weil wir so schöne Bilder gemacht haben am Anfang. Da haben wir gedacht, jetzt haben wir aus finanziellen Gründen wieder irgendwas, was nicht funktioniert. Aber das kriegt man schon weg und dafür war es sehr günstig.
Julia: Schaut ihr zwischendurch während der Dreharbeiten das Material an?
T: Ja. Das Labor haben wir in Rom gehabt und auch die Entwicklung. Da kriegen wir so alle drei, vier Tage die Festplatte.
R: Das war sehr angenehm.
T: Bei „La Pivellina“ war es auch so, da haben wir auch gleich reingeschaut.
R: Bei „La Pivellina“ war das Kopierwerk quasi gleich neben dem Platz, wo wir gedreht haben praktischerweise. Das waren vielleicht 500 Meter von dort, wo wir gedreht haben.
Julia: Und braucht ihr das auch, um zu entscheiden, was in den Film kommt?
R: Es ist eher eine Sicherheit, um zu sehen ob technisch etwas schief gegangen ist. Dass man weiß, das Material ist was geworden. Im Grunde geht es darum, ist es scharf, ist ein großer Fussel drinnen… Wiederholen kann man die Sachen meistens eh nicht.
Jakob: Stellt das Material, die Menge, die ihr zur Verfügung habt, eine Begrenzung für eure Arbeit dar?
T: Wenn Material ausgeht, dann kann man es natürlich schon nachbestellen. Es ist halt eine gewisse Begrenzung da, denn um so mehr Material man verwendet desto teurer wird natürlich alles. So wie das Material an sich für uns schon eine Begrenzung ist, also mit dieser Länge von 11 Minuten. Da es eben etwas kostet, beschränken wir uns schon auch und sagen wir verwenden das Material, das wir haben und schauen, dass wir damit auskommen.
Julia: Ihr achtet dann sicher sehr genau darauf, wann der Moment ist, die Kamera auszulösen?
R: Natürlich, das ist ganz konzentriert. Also nicht so wie bei Video, wo du mal die Kamera laufen lässt und man alles filmst, was einem über den Weg läuft. Es ist immer sehr konzentriert, das gefällt mir auch sehr gut beim Filmen.
T: In dem Moment wird ja die Klappe geschlagen, damit wir Ton und Bild synchron kriegen. Das heißt die Leute wissen in dem Moment, wo die Klappe geschlagen ist, da brauche ich Zeit die Klappe hinzutun, die Angel zu nehmen und dann dürfen sie anfangen. Und sie wissen, dass das nicht lustig ist. Das ergibt sich dadurch dass man mit Film dreht und wenig Material hat. Wir wissen, es ist eine Rolle und es muss ungefähr passen, dadurch ist es für die Leute auch etwas ganz anderes. Etwas ganz anderes, als wenn man auf Video drehen will. Die können auch nicht sagen, lass mich einmal schauen.
R: Auch für uns. Den Abstand den man dann hat, da sieht man dann auch alles wieder ganz anders. Dadurch dass man es nicht sofort sieht auf einem Bildschirm oder einer Ausspielung, sondern immer erst im Abstand von ein paar Tagen, wenn man das Material bekommt. Und da hat man dann schon eine gewisse Distanz dazu. Wir sind gewohnt so zu arbeiten. Auch von der Fotografie her. Weil wir quasi noch so aus dem Analogen kommen, auch in der Fotografie, da war es auch einfach nicht üblich, außer bei Polaroid…aber selbst Polaroid ist nicht sofort da, sondern kommt so langsam, das ist ein Überraschungseffekt. Und so ist es auch, diese gewisse Distanz und den Abstand, den man durch diese zeitliche Distanz bekommt, bis man das Material dann zu sehen bekommt, die, finde ich, ist sehr wichtig.
Julia: Also habt ihr nie in Erwägung gezogen aus Kostengründen umzusteigen?
T: Wir haben das in Erwägung gezogen als wir merkten wir kriegen kein Fuji Material mehr und wir können uns das Kodak nicht leisten. Da haben wir kurz überlegt, wie es wäre, wenn wir mit 2K Kameras, Black Magic oder so, drehen würden. Aber da haben wir gesehen, dass wir mehr Technik bräuchten und Festplatten. Also wir haben es ganz kurz überlegt, also klar, wir werden auch mit der Zeit gehen müssen. Wenn es kein Filmmaterial mehr gibt, werden wir uns auch ändern müssen. Aber wir haben es ganz kurz überlegt, weil wir unsicher waren, dass sich das alles ausgeht.
R: Weil es natürlich auch verlockend ist, man kann ja auch toll arbeiten mit Video. Natürlich ist es verlockend, wenn man weiß das kostet im Grunde erstmal nichts. Aber das ist auch ein Trugschluss. Es kostet auch etwas. Da ist die Postproduktion sehr teuer und die ganzen Festplatten, die man braucht. Dann muss man das immer absichern das Material und dann weiß man nicht, was ist dann in 10 Jahren, dann kann man das nicht mehr lesen. Da ist Film eigentlich ein einfach zu handelndes Medium.
T: Und man muss sagen, jetzt, wo wir wieder das Material gesehen haben, sind wir wieder auf der militanten Seite. Nie wieder Video! Film, weil es einfach so fantastisch ist.
R: Aber das Wissen über Film geht auch verloren in den Kopierwerken. Die meisten Kopierwerke entwickeln auch nicht mehr und dann gehen viele Leute, die entwickelt haben und die Farbbestimmung gemacht haben gehen in Pension. Oder jetzt wo wir in Italien in dem Filmlabor waren, da ist unten ein riesiger Saal, wo früher dreißig NegativCutter gesessen sind,…
T: …dreißig Schnitttische…,
R: …und das ist jetzt leer. Das gibt es gar nicht mehr. Die sind jetzt irgendwo in Rente geschickt und da geht natürlich viel Wissen verloren. Das heißt, wenn man auf Film arbeitet, da ist man sehr auf die Kopierwerke beschränkt, die das überhaupt noch machen.
Julia: Mit was für einer Kamera dreht ihr?
R: Eine Aton, das ist eine französische. Die ist aus den 70iger Jahren.
T: Von Anfang an. Gestern, wo ich mit einer Freundin geredet habe, die sich eine neue Kamera gekauft hat, weil sie Fotografin ist, kauft sich im Abschnitt von 2 Jahren immer eine neue Fotokamera. Da haben wir gesagt, wir drehen jetzt 15 Jahre mit der gleichen Kamera. Die müssen wir nie wechseln.
R: Die ist wahrscheinlich 1976 gebaut.
Julia: Bei „Das ist alles“ dreht ihr noch ausschließlich vom Stativ und dann wird es immer ein bisschen bewegter bei „Babooska“ ist es teilweise vom Stativ, oder?
R: Ja, ein paar Szenen sind vom Stativ.
Julia: Und dann bei euren letzten Filmen ist alles von der Schulter gedreht. Wie kommt das?
R. Das ist sicher, weil wir von der Fotografie kommen und am Anfang…
T: …wollten wir sprechende Fotografien haben.
R: Da ist uns Fotografie irgendwie zu wenig gewesen und wir wollten da eine Erzählung hineinbekommen. Im Grunde sind es Fotos, die dann erzählen. Das sind alles fixe Einstellungen. Und bei „Babooska“ wollten wir das auch alles statischer machen, aber dann sind wir drauf gekommen, dass das nicht geht. Mit diesem Thema vom reisenden Zirkus ist das wahnsinnig schwer. Da muss man sich auch die ganze Zeit im Wohnwagen bewegen. Da sind wir dann vom Stativ abgekommen und haben Handkamera gemacht. Und in „La Pivellina“ gibt es dann gar kein Stativ mehr.
T: Jetzt bei „Mister Universo“ gibt es auch keine Aufnahmen vom Stativ. Der Rainer hat jetzt so eine super Bauchstütze, weil er muss ja auch die Objektive tragen und Belichtungsmesser.
R: Ja, da gibt es in Wien noch so einen Bastler, der hat aus so verschiedenen Schulterstativ-Bauteilen, auch so alte Arri Sachen, so ein eigenes zusammengebastelt. Da kann ich die Kamera jetzt auf der Schulter haben, habe aber beide Hände frei. Ich kann quasi beide Koffer tragen, links und rechts, ohne das die Kamera runterfällt.
Julia: Das heißt, das ist schon eine klare Entscheidung für die bewegte Kamera.
R: Jetzt für diesen Film schon. Und ich mache das auch sehr gerne, weil man sehr spontan sein muss, das ist ja eine dokumentarische Arbeitsweise, man muss quasi intuitiv Kameraführung machen. Und das, finde ich, ist eine schöne Arbeit. Manchmal gelingt es, manchmal weniger. Vor allem auch weil ich Schärfe machen muss. Aber das kommt halt der Fotografie dann sehr nahe, wo man quasi allein mit der Kamera so seinen Blickwinkel aussucht. Wir verwenden auch kein Licht. Da arbeiten wir einfach mit Zufall und der Wirklichkeit.
Jakob: Also war das gewissermaßen der Übergang vom Fotografischen zum Filmemachen.
T: Das war definitiv so. Wir haben ja diese Leute kennengelernt, wir waren drei Sommer dort. Den ersten Sommer haben wir sie fotografiert, im zweiten Sommer haben wir schon besser Russisch gekonnt und da haben sie uns Geschichten erzählt, die sie uns schon im ersten Sommer erzählt haben, die wir aber nicht verstanden haben. Und irgendwie haben wir dann wunderschöne Mittelformatfotos gehabt von diesem Pärchen und wir haben immer allen Leuten die Geschichten erzählen müssen, die die uns erzählt haben. Und das war uns einfach zu wenig. Und dann, ich meine, der Reiner hat auch schon vorher Kurzfilme gemacht, bei mir was es der erste Film, haben wir gesagt, wir machen das jetzt, wir wollen jetzt eigentlich sprechende Fotografien haben. Wir wollen, dass sie Geschichten erzählen, die sie uns erzählen, aber diesmal so, dass wir sie teilen können. Da waren wir ganz sicher, dass sie einfach in ihrer Küche sitzen müssen und uns die Sachen erzählen, die sie uns sonst auch immer erzählen. Bei „Babooska“ hat uns das gefallen mit dem Stativ. Da haben wir auch gedacht, wir machen alles vom Stativ. Aber als wir die erste Szene gedreht haben war alles so eng und alle sind über das Stativ gestolpert. Das war dann eigentlich eine ganz schnelle Entscheidung. Weil am Anfang haben wir doch eher so dogma-mäßig gedacht, das ist gut, fixe Einstellung und Stativ. Das haben wir aber sofort gemerkt, dass das in diesem Film nicht geht. Und danach haben wir die Qualität einer Handkamera entdeckt. Es ist entstanden aus einer Notwendigkeit und jetzt ist es so, dass wir auch viele fixe Einstellungen haben, die immer ein gewisses Spiel haben, weil es eben von der Schulter gedreht sind, was dem Bild aber keinen Abbruch tut. Also der Rainer ist manchmal unzufrieden, aber ich finde das absolut legitim, wenn das Bild nicht ganz grade ist. Dass man merkt, dass es Handkamera ist, auch wenn es statische Bilder sind.
Julia: Was für ein Drehverhältnis habt ihr?
R: 1 zu 10 oder so…
T: …ein relativ hohes Drehverhältnis, nicht, weil wir die Sachen so oft machen, sondern weil wir irrsinnig viele Geschichten machen, die dann alle rausfallen. Also es sind immer auch ganz schöne Geschichten, zum Beispiel bei „Glanz des Tages“ , da war der Walter lungenkrank und war beim Arzt und bei der Blutabnahme und es gab Gespräche mit dem Arzt und das sind irrsinnig wunderschöne Sachen geworden, die haben dann einfach im Schnitt nicht mehr reingepasst. Und so gibt es auch bei „Mister Universo“ und „La Pivellina“ ganz viele Nebengeschichten wie der Tairo lernt Messer zu werfen oder so Dinge. Die erhöhen das Drehverhältnis aber die können wir dann leider nicht rein tun, weil das dann zu wenig dem Bogen entspricht oder zu weit weg führt vom Kind.
Julia: Das heißt der Film entsteht dann auch zu einem großen Teil im Schnitt?
T: Absolut. Also der Schnitt ist ganz tricky. Da brauchen wir oft ganz ganz lang. Weil durch das Fragmentarische ist es so, dass wenn du eine Szene raus tust, dann fällt das ganze Konstrukt zusammen. Das ist so sensibel. Das musst du ganz oft anschauen und ausprobieren. Auch die Längen und die Zeiten und so. Der Schnitt von „Glanz des Tages“ war extrem schwierig. Da hatten wir keinen definitiven Anfang und kein klares Ende. Wir haben lange überlegt, beginnen wir mit Schwabemünchen, der Heimatstadt von Walter oder hören wir damit auf. Das wäre alles möglich gewesen. Und das hat es sehr schwierig gemacht. Wenn ich jetzt „Mister Universo“ schneide ist das relativ einfach, auch weil das chronologisch gedreht wurde. Am Anfang das Eisen und am Ende verschwindet der Mister Universum. Wir haben noch eine Parallelhandlung, die sich bisschen schieben lässt, aber es ist relativ einfach den Bogen zu spannen. Leider fallen viele schöne Geschichten raus, das ist halt traurig. Da brauchen wir immer ziemlich lange, um uns zu verabschieden. Das ist eigentlich der schmerzhafteste Teil – die Verabschiedung von Dingen, die du gemacht hast, die schön geworden sind, die unbedingt haben willst, die aber dann die Geschichte schlechter machen und dann müssen sie halt rausfallen.
Julia: Und du, Tizza, schneidest und Rainer kommt dann manchmal dazu?
R: Genau.
T: Also jetzt ist es auch so, dass ich das einfach schneide und wenn ich Sachen nicht genau weiß, dann hilft mir der Rainer. Und wenn der Rohschnitt da ist fangen wir definitiv an zusammenzuarbeiten. Da ist es ganz wichtig, dass der Rainer dabei ist. Aber jetzt weiß ich auch ganz genau von den Dreharbeiten, welche Szene mir am Besten gefallen hat und welche Szene gut funktioniert hat. Da brauche ich den Rainer nicht. Aber dann, wenn der Bogen gespannt ist, dann schon. Dann ist er schon viel dabei. Wir machen eigentlich alles gemeinsam, aber es braucht immer irgendwie einen Chef. Und im Schnitt habe ich das letzte Wort, das ist einfach mein Metier. Wie er auch an der Kamera immer sagt, welches Objektiv verwenden wir, machen wir Schwenks oder nicht. Wenn er es dann macht, dann macht er es, da kann ich nicht sagen, so wollte ich das nicht. Das Buch schreibe ich auch erstmal so wie ich es will und der Rainer sagt dann halt was man ändert. Aber das ist schon so, da brauchst du schon immer einen, der sagt, das ist mein Teil, das entscheide ich in einer gewissen Art und Weise. So dass es weitergeht, denn immer zu zweit alles zu entscheiden das ist nicht möglich.
Julia. Eure Arbeitsteilung hat sich wahrscheinlich auch über die Zeit in der Arbeit an den Filmen so herauskristallisiert?
T: Ja, auch was jeder gerne macht. Der Rainer ist ein recht chaotischer Mensch, der wäre für den Schnitt nicht recht geeignet.
R: Ich bin eher so für den Feinschnitt zu haben, das mache ich sehr gerne.
T: Ja. Aber das hat sich einfach so ergeben. Dass ich gerne schneide und das relativ gut kann und das einfach gerne mache. Und der Reiner nicht so.
R: Das ist auch immer so, ich feile lieber an den Dingen.
T: Er ist der Feiler. Auch beim Schreiben. Ich schreibe irrsinnig schnell und viel und total gern und der Rainer feilt dann dran. Auch bei den Drehs, brülle ich meistens rum und dann machen wir das so und dann feilt der Reiner dran und dann machen wir es nochmal. Da bin ich ein impulsiverer Typ. Ich bin ganz ganz schnell im Filmen, und der Rainer bringt dann die Präzision rein.
Julia: Und die Aufteilung von Kamera und Ton?
T: Das ist ganz fix. Der Rainer macht Kamera und ich Ton. Was für mich super ist, da ich auch Fotografin bin, weiß ich einfach wie das Bild aussieht, wenn er ein 50iger Objektiv drauf. Ich stehe ja immer ganz nah bei ihm wenn ich Ton mache und schaue manchmal auch das Bild vorher an. Bei „Glanz des Tages“ habe ich teilweise den Ton nicht selber gemacht und da habe ich extrem drunter gelitten, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nicht nah genug dran bin, um entscheiden zu können, ob es gut war oder nicht.
R: Für mich ist es einfach total wichtig durch die Kamera zu schauen, durch die Kamera zu sehen, was passiert. Dabei ist es ja…das ist so ein gesponnener Gedanke…im Grunde genau das, was du filmst genau das, was nicht am Film ist. Durch die Blende kommt ja immer genau das Bild, was man nicht sieht. Das finde ich auch, im Film das Spannende. Das sind so Gedanken, die man da haben kann. Und das ist dann vielleicht auch das Überraschende. Dass man das Gefühl hat oder man überrascht ist, wenn man das Material dann sieht. Obwohl es jetzt auch nicht so einen Unterschied macht.
Julia: Es fällt auf, dass eure Filme immer wieder eine gewisse Art des Zusammenhalts und des zwischenmenschlichen Zusammenlebens thematisieren. Ist das etwas, wonach ihr bewusst sucht, oder ist das erst mit der Zeit und den Filmen entstanden?
T: Ich würde schon sagen, dass ich in den Filmen und in den Charakteren immer eine gewisse Art von Menschlichkeit suche, die sehr schwer darzustellen ist, ohne dass sie kitschig oder pathetisch ist. Oder suche, etwas von Menschen zu zeigen, die selbst ein hartes Schicksal haben, Leute, die dann andere Menschen vielleicht besser verstehen. Das betrifft aber eben ganz minimale Regungen, was man eben Menschlichkeit nennen könnte. Für mich ist das schon eine essentielle Suche nach dem, was den Menschen eigentlich ausmacht. Daher ist es auch wichtig, dass ich die Personen, mit denen ich arbeite sehr gerne mag und sie mich wirklich faszinieren.
R: Die Personen, mit denen wir arbeiten, leben ja gesellschaftlich quasi am Rande, außer Philip, das ist wieder was anderes, aber das ist dann genau das Faszinierende an diesen Mikrokosmen, wie sie untereinander einen Zusammenhalt erzeugen, um sich irgendwie auch gegen Außen zu schützen. Das kann in einer Familie sein, also wie eine Familie ineinander Halt sucht, wie das bei den Auswanderern zum Beispiel der Fall ist, die in ein fremdes Land kommen und dort nie willkommen sind, leider, das wiederholt sich ja alles, und dann aber in ihrem kleinen Mikrokosmos einfach einen Halt suchen. Und so ist das im Zirkus natürlich auch. In den Zirkusfamilien ist die Familie nur etwas größer und sie bilden zusammen eine eigene Gesellschaft. Das ist schon etwas, was uns oder mich zumindest fasziniert. Wie das dann auch das Zwischenmenschliche betrifft, ist natürlich wieder etwas anderes. Da gibt es wieder ganz andere Spannungen und Probleme, die auftauchen. Das ist auch bei „La Pivellina“ so, wie alles in der Welt da, in dem Wellblechzaun, zusammenhält. Aber wir erzeugen das nicht bewusst, sondern das sind eben einfach die Menschen, die uns interessieren, die sind einfach so.
Julia: Ist das in „Mister Universo“ ähnlich?
R: Ja, auf jeden Fall. Da geht’s auch wieder um diese ganz eigene Welt, wo die Menschen sich einfach gegenseitig helfen. Natürlich gibt es dort auch Probleme, das ist überhaupt nicht zu idealisieren, aber es gibt dort eben eine besondere Art des Schutzes In dem Fall ist es ja Tairo, der glaubt – natürlich ist in dem Fall viel Fiktion dabei – dass dieser Glücksbringer ihn schützt. In Wirklichkeit ist es aber seine Familie, sein Umfeld, dass ihn beschützt, das sind einfach die Menschen. Und das ist etwas, was sich da durchzieht. Also unsere Protagonisten sind schon meistens sympathisch. Das ist für uns, wie du schon gesagt hast, einfach wichtig. Es ist ja irgendwie auch einfacher, das Negative, das Schlechte und Hässliche zu zeigen. Das Schöne ohne Kitsch oder Pathetik zu zeigen ist irgendwie reizvoller.
T: Dazu kommt natürlich immer doch der Humor, der für unsere Filme sehr wichtig ist, die Situationskomik. Bei „La Pivellina“ hat es uns so extrem fasziniert, dass wir eine tragische Geschichte erzählen, aber man permanent lachen muss. Aber das ist eben genau so, wie wir es im wirklichen Leben auch erleben. Man kann in einer Situation, wo vielleicht ein Freund gestorben ist, trotzdem total lachen. Im Film ist das aber immer eine traurige Situation. Es kommt traurige Musik und man ist todtraurig. Aber im Leben ist es so, dass traurige Situationen sehr, sehr traurig sein können oder teilweise eben auch lustig sein sind, bevor sie wieder traurig sein können. Dieses Explizite: Es ist weiß oder es ist schwarz, das gibt es im wirklichen Leben nicht. Das gibt es für einzelne Momente ganz bestimmt, aber das zieht sich nicht durch. Bei „La Pivellina“ war es dann eben so, dass es trotz der traurigen Geschichte dem Mädchen gut geht, sie haben es lustig miteinander. Und in „Mister Universo“ ist es ganz extrem gelungen, dass Dinge, die eigentlich dramatisch sind, sehr witzig geworden sind, ohne dass wir das wollten. Das ist dann etwas ganz Besonderes, was sich da drin entwickelt. So entsteht dann eben zur Dramaturgie ein Schnitt Das sind so Dinge, wenn man sie schreibt, klingen sie total blöd, aber wenn sie wirklich passieren, die Situation sich dann zum Komischen entwickelt, dann finde ich das total super.
Jakob: Wäre das sozusagen ein Teil der Realität, den man durch einen „bloßen“ Dokumentarfilm nicht einfangen oder darstellen könnte?
T: Dokumentarfilm gibt es gar nicht. Man sieht unsere Menschen, die Protagonisten, nur durch diese eine Geschichte, das heißt, der sucht jetzt eben das Eisen. Und dadurch ist dann alles, was er sagt konnotiert und das, was er tut, wird durch den Zuschauer damit verbunden. Wenn man das ohne diese Geschichte zeigen würde, würde das, was er sagt und tut, nicht die Bedeutung bekommen, wie wenn wir es mit der Geschichte zeigen. Genau das Gleiche ist es mit dem Kind. Wenn das Kind da wohnt, dann hat es nicht die Bedeutung wie wenn es die Mutter nicht hat. Dadurch kann man etwas ganz anderes hinein interpretieren. Und das macht das aus, finde ich. Das ist eigentlich ein kleiner Trick. Dass man den Leuten mehr gibt hineinzuinterpretieren, als wirklich ist. Und im Dokumentarfilm ist nur das, was wirklich ist. Wenn man so eine Geschichte entwickelt, dann kann man ein bisschen mehr hineintun und dadurch auch sehr gut Emotionen hervorrufen. Im Dokumentarfilm hat man diese Möglichkeit eigentlich nur in besonders dramatischen Situationen. Wenn man ein Kind beim Spielen beobachtet, ist das eigentlich langweilig, wenn man aber etwas weiß wie, das Kind hat seine Mutter verloren, dann beobachtet man es mit ganz anderen Augen. Das ist der kleine Trick dabei, der natürlich auch bei uns selbst funktioniert. Wir beobachten das dann auch mit ganz anderen Augen und interpretieren etwas ganz anderes hinein.
Julia: Wie funktioniert diese Arbeit mit einem professionellen Schauspieler wie Philip Hochmaier?
T: Er hat sich, glaube ich, sehr schwer getan. Für einen Schauspieler ist es die größte Beleidigung, wenn man sagt, sei du selber. Wenn ich Walter sage, geh’ ins Café und hol’ dir einen Kaffee, dann gibt es für Walter nur eine Art ins Kaffeehaus zu gehen und den Kaffee zu bestellen. Für Philip gibt es 100 Arten. Bin ich traurig oder lustig, war ich davor bei meiner Freundin oder nicht, und die hat er im Kopf, die kann er alle spielen. Das ist aber für den Menschen Philip Hochmeier, nicht Schauspieler, nur eine Art Kaffee zu bestellen. Das war unsere Arbeit mit ihm und die war relativ schwierig, weil das Philip einfach immer zu wenig war, um zu zeigen, was er kann. Aber für uns war es nur interessant, wenn er nicht gezeigt hat, was er kann. Und das war ein Kampf. Bis wir ihn dahin gekriegt haben, wo wir wollten, und er trotzdem noch damit glücklich war.
Julia: Aber es war von Anfang an für ihn klar, dass er keine Rolle spielt, sondern quasi er selber ist?
T: Ja, das war ihm schon klar. Das war eine große Herausforderung, auch für ihn, wirklich. Wir konnten dem Philip ja auch nicht sagen, dass ein Laiendarsteller nie fragt: In welcher Situation bin ich? Schneidet ihr das an den Anfang vom Film, oder in die Mitte oder ist das schon am Ende vom Film? Das interessiert den Laiendarsteller gar nicht. Philip hat das ganze Wissen vom Theater und Film und will wissen, in welcher Situation er sich befindet. Ist er traurig, oder ist er nur lustig oder… Für uns ist aber irrelevant, in welcher Situation er jetzt ist. Aber ein Schauspieler glaubt es wissen zu müssen, um es gut zu machen.
R: Wir wollten den Philip also zum Laien machen.
T: Und das ist eigentlich eine Beleidigung. Ein paar Mal ist es uns gelungen, das war einfach wirklich sehr schwer. Durch das permanente Spielen und jemand Anderes sein steckt gar nicht mehr viel Laie in ihm.
R: Das ist ja auch logisch. Philip ist eben anderes, wie zum Beispiel Filmsets gewohnt. Philip ist ein sehr offener Mensch und wollte er den Film von Anfang an machen. Erst beim Filmen ist ihm ganz bewusst geworden, worauf er sich da jetzt eingelassen hat. Aber er hat es dann bis zum Ende durchgezogen. Obwohl das für ihn auch sicher nicht so einfach war. Es mag ihm als jemand, der eine andere Art von Filmemachen gewohnt ist, ja auch oft unprofessionell vorgekommen sein.
Julia: Wie geht ihr mit Wiederholungen um, wenn ihr mit den Laien eigentlich immer den ersten Take nehmt?
T: Man kann es wiederholen, aber man kann nicht eine zufällige Geste oder Situation, die im ersten Take stattgefunden hat und die super war, die kann man nicht nochmal verlangen. Das funktioniert nicht. Das heißt jede Situation, jeder Dialog, der einmal gut funktioniert hat, ist nicht wiederholbar. Das heißt, du musst dich, wenn du mit der Szene nicht zufrieden bist, davon verabschieden, dass du sie nochmal machen kannst. Mit dem gleichen Text, aber dafür scharf, oder so etwas, das geht nicht. Das heißt, das sind alles einzelne Textversuche, einzelne Situationen und ganz einzelne Gespräche. Das geht einfach nicht, das zu wiederholen.
R: Wobei man sagen muss, bei den Dreharbeiten höchst professionell waren die Kinder. Also mit der Pivellina, die ist jetzt mittlerweile neun, haben wir auch ein paar Szenen gedreht und die hat mit uns dreimal, also dreimal dieselbe Szene gedreht. Ganz authentisch, spontan und perfekt. Sie hat sogar den Text gesagt, aber total echt.
T: Aber es ist schon die erste Klappe meistens die Beste. Das habe ich jetzt auch alles verwendet. Natürlich funktioniert das andere auch, aber wenn man es sich zehnmal anschaut, spürt man den Unterschied. Wenn man es sich nur einmal anschaut, spürt man es vielleicht nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da total einen Unterschied gibt. Bei Kindern ist es super, man kann sie einfach in Situationen hineinversetzen. Wenn man sagt, Tairo, setz’ dich jetzt da hin und erzähl’ den Kindern die Geschichte. Wenn der Tairo das gut macht, vergessen sie die Kamera und die Fragen und hören nur diese Geschichte. Aber die Geschichte ist auch nur gut, wenn sie sie das erste Mal hören. Beim zweiten Mal ist sie schon nicht mehr ganz so gut und beim dritten Mal fangen sie schon an zu gähnen. Die Konzentration auf die erste Klappe ist schon enorm, auch für uns.
R: Und umso schwieriger wird es dann natürlich, desto mehr Vorgaben wir ihnen geben. Je mehr Text vorgegeben ist und je mehr Wendungen im Text sein müssen, damit das für die Geschichte im Film passt, desto schwieriger wird es. Deswegen habe ich die rein dokumentarischen Szenen immer am liebsten, wo sie hingehen und wo man schaut, was passiert. Die sind ja auch sehr wichtig, weil es dort um ihre Persönlichkeit geht.
Jakob: Daraus ergeben sich dann auch immer besondere Charaktere, die so etwas tragen, nehme ich an.
R: Genau, deswegen haben wir den Tairo auch als Hauptprotagonisten ausgewählt.
T: Tairo hat das Talent im richtigen Moment das Falsche zu sagen, zu einhundert Prozent. Er ist ein absoluter Provokateur. Allein durch sein Auftreten ärgert oder diskreditiert er die Leute. Er macht mit Sicherheit genau das, was du nicht willst, dass er es macht. Und das ist ganz selten zu finden. Er hat uns natürlich irrsinnig viel Nerven gekostet, aber es hat sich wirklich ausgezahlt.
Jakob: Und beim Walter, wie lief das?
T: Der Walter ruht so in sich, der hat so eine Geschichte. Du die Kamera auf ihn richten, er tut gar nichts und das ist seine Geschichte. Der ist einfach präsent, wenn er erzählt und was bei ihm so schön ist, es gibt Menschen, die wie Kinder geblieben sind, d.h., wenn die von sich erzählen, dann ist es total echt. Das ist ein ganz großes Talent vom Walter.
R: Ja, das hat natürlich auch mit seiner Geschichte zu tun. Dieses Kind, das so gedemütigt worden ist, das einfach immer noch in ihm drin ist. Auch oft während es Drehens vergisst er, dass das jetzt für den Film ist. Das war in manchen Szenen auch für uns schwierig, da ziehen wir Grenzen. Wenn es zu persönlich oder zu privat wird, dann schützen wir schon unsere Protagonisten.
T: Absolut.
R: Besonders beim Walter war das so.
T: Aber zugleich, wenn er nach Schwabemünchen, in seinen Heimatort kommt, dann ist die erste Klappe, geh’ hin und schau doch mal dein Haus an. Er war 30 Jahre lang nicht mehr in diesem Haus und er geht hin und streichelt die Bäume. So eine Regie, die hätte ich niemals, so etwas wie, Walter jetzt streichle und umarme einmal die Bäume. Das ist saublöd. Aber wenn er das dann wirklich tut und du hast das dann noch in der Kamera, dann ist das wirklich das einzige, was diese Arbeit legitimiert. Diese Momente sind es, was es für mich auszeichnet oder warum ich das gerne mache.
R: Das sind die Bäume, die er wie er klein war das letzte Mal gesehen hat, und jetzt sind die so dick wie Elefantenfüße, stehen in die Höhe, und er streichelt darüber und begrüßt sie quasi. So etwas kann man nicht, oder vielleicht kann man es schreiben, aber wenn das spontan jemand macht und man ist mit der Kamera dabei…
T: Man kann es schreiben, man kann es spielen, man kann irrsinnig mehr einfangen, wenn man irrsinnig drauf drückt, nicht wie wir, aber für mich ist es halt genau dieser Moment. Dass er mir etwas zeigt, was ich mir niemals ausmalen hätte können, das ist es es, was mir gefällt. Immer wird man auf das zurückgeworfen, was einem selbst gefällt. Die Leute merken das oft gar nicht. Da lernt man auch sehr viel über das Leben, finde ich.
Jakob: Ich musste auch an die Szene in „Glanz des Tages“ denken, in der er einen Abdruck von Philip nimmt und anfängt Messer zu werfen. Am Ende der Szene, so wie es geschnitten ist, sagt er kurz, du bist genauso wie dein Vater. Da spielt er ja auch irgendwie mit.
R: Da spielt er super mit, das muss man auch sagen. Walter ist schon ein Mitspieler, ein Schauspieler ist er auch, aber das ist auch schon unsere Aufgabe ihn da so hineinzuversetzen, dass er wirklich glaubt, dass der Vater vom Philip sein Bruder ist.
T: Und dann hasst er seinen Bruder.
R: Da ist auch das Psychologische dann das Spannende. Manchmal ist das auch zu weit gegangen und der Walter hat wirklich alles in den Philip hineinprojiziert.
T: Dass er einen Hass auf seinen Bruder hat.
R: Er hat tatsächlich so einen Hass auf seinen Bruder. Und in dieser Szene da spielt er wirklich mit, das ist dann wirklich sehr spannend. Manchmal geht es aber auch zu weit, dann wird es zu persönlich, dann kann man das nicht mehr in den Film reinnehmen. Denn man möchte den Leuten auch etwas zurückgeben, da kann man sie nicht so ausnutzen. Aber natürlich ist es als psychologisches Experiment spannend, wenn man dadurch sieht, was für eine Person der Walter ist.
In dem Fall war es zum Beispiel Philipp, der uns erzählt hat, dass es diese Statue gibt und ob wir die nicht für den Film verwenden wollen. Diese Statue gibt es ja wirklich im Burgtheater, die steht da im zweiten Stock. Unsere Filme leben dann von solchen spontanen Einfällen, die auch von den Protagonisten kommen. Und wir müssen das zulassen. Philip muss ja auch selbst Humor haben, solch’ seine Szene zuzulassen.
*Das Interview führten Julia Tielke und Jakob Häußermann schon im Herbst 2015. Mister Universo war 2017 in einigen deutschen Kinos zu sehen, seit Herbst 2017 ist er auf DVD erhältlich. Das Gespräch ist also zwar alt, aber immer noch lesenswert, wie wir finden.
Transkript und Bearbeitung: Tielke / Häußermann.