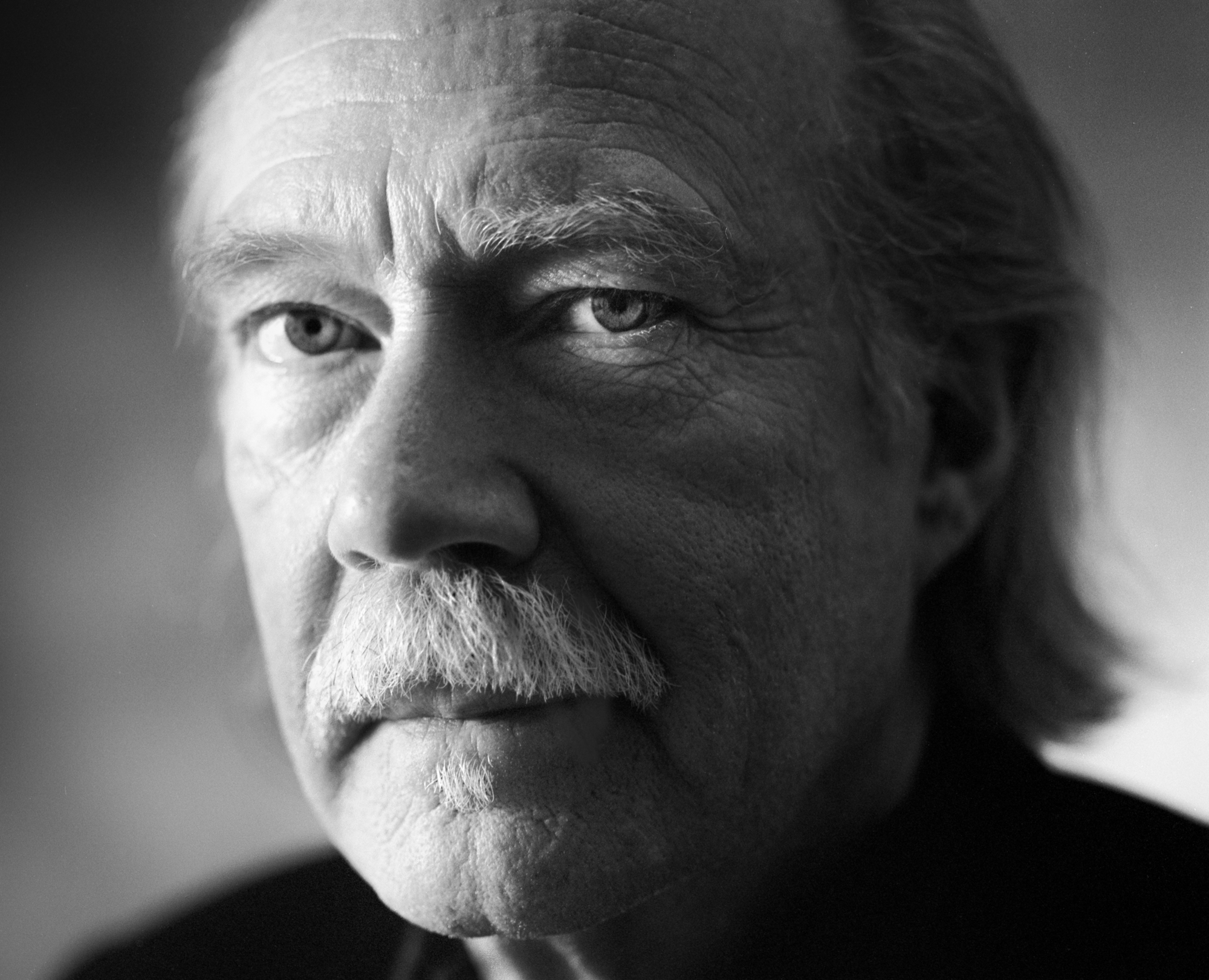Revolver Live! mit dem Kameramann Jürgen Jürges, im Rahmen der Diagonale Graz. Am 07.04.2024, 14 h. Mit Christoph Hochhäusler und Nicolas Wackerbarth.
 Birthe Carolin Sebastian hat mit Mia Hansen-Løve ein spannendes Gespräch über ihren Film „L’Avenir“ (deutscher Verleihtitel: „Alles was kommt“) und vieles mehr geführt. „L’Avenir“ ist ab morgen, 18.8.2016, in ausgewählten Kinos in Deutschland zu sehen. Wir freuen uns sehr das Interview bereits heute hier auf dem Blog veröffentlichen zu dürfen.
Birthe Carolin Sebastian hat mit Mia Hansen-Løve ein spannendes Gespräch über ihren Film „L’Avenir“ (deutscher Verleihtitel: „Alles was kommt“) und vieles mehr geführt. „L’Avenir“ ist ab morgen, 18.8.2016, in ausgewählten Kinos in Deutschland zu sehen. Wir freuen uns sehr das Interview bereits heute hier auf dem Blog veröffentlichen zu dürfen.
Die Redaktion
In ‚L’avenir’, dem neuen Film von Mia Hansen Love spielt Isabelle Huppert Nathalie, eine verheiratete Philosophie-Professorin um die 50, Mutter von zwei Kinder – die von ihrem langjährigen Ehemann für eine Jüngere verlassen wird. In einem Alter also, in dem es nicht ganz einfach ist, das eigene Leben wieder aufzubauen.
Birte Carolin Sebastian: Warum der Titel ‚L’avenir’ oder auf deutsch: ‚Alles was kommt’?
Mia Hansen-Løve: Zunächst lag tatsächlich etwas Ironisches in diesem Titel, weil ich selbst nicht das Licht am Ende des Tunnels im Leben dieser Frau gesehen habe. Das interessante an diesem Film für mich war, dass ich erst beim Machen, danach, und sogar als ich ihn selbst gesehen habe, realisiert habe, dass der Film eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Und dass der Titel viel weniger ironisch ist als am Anfang gedacht. Auch wenn es kein happy end gibt in diesem Film, eher ein offenes Ende, sieht die Zukunft dieser Frau doch heller aus, als zu der Zeit, in der ich das Drehbuch geschrieben habe. Und das obwohl ich versucht habe, ehrlich zu bleiben, nicht zu schönen, nicht optimistischer zu sein oder lustiger als es ist.
Der Film ist inspiriert durch Ihre Mutter….
Ja sehr. Als ich angefangen habe, den Film zu schreiben, bin ich von sehr persönlichen Dingen ausgegangen. Beim Machen habe ich gespürt, warum ich diese Person so mag: weil sie so viel Kraft hat. Erst danach habe ich begriffen, dass es beinahe eine Art Hommage an meine Mutter darstellt. All das war mir nicht in dem Maße bewusst, als ich angefangen habe, zu schreiben.
In welchem Sinne?
Ausgangspunkt ist eher eine banale Alltagssituation, die viele unterschiedliche Schicksale mit einschließt. Doch für mich war es initiativ das Portrait einer Intellektuellen, die plötzlich mit dem Verlassen-sein, mit Einsamkeit konfrontiert ist, die aber gleichzeitig eine besondere Form von Weisheit oder innere Stärke beweist.
Es hat mich interessiert von ihrer speziellen Persönlichkeit zu erzählen und auszugehen. Ich habe nicht den Eindruck, dass man so einen Charakter schon oft im Kino gesehen hat. Man sieht bestimmt viele Frauen, auch viele verlassene Frauen, Dramen über Trennungen, aber keine Frau, die ihre Kraft nicht aus dem Zusammensein mit Männern zieht, sondern aus ihrer inneren Welt. Das habe ich bei meiner Mutter beobachtet und fand es sehr schön. Darin liegt für mich die Originalität, die Essenz des Films. Erst danach ist mir klar geworden, dass darin auch etwas sehr universales liegt, dass sich viele Menschen darin wiederfinden können, da viele Frauen so eine Situation erlebt haben oder erleben: sich in einem Alter verlassen und allein wiederzufinden, in dem es nicht so leicht ist, sich wieder ganz neu aufzustellen.
Welche Rolle spielen ihre geliebten Bücher bei der Trennung? Sie macht keine Szene, als ihr Mann die Trennung bekannt gibt.
Diese Frau hat eine sehr enge, sogar affektive Bindung zu Büchern. Auch Bücher haben etwas Menschliches. Ein Haus mit Büchern gefüllt, strahlt für mich immer eine menschliche Wärme aus. Das habe ich meine gesamte Kindheit hindurch so empfunden: ich bin in einem Apartment aufgewachsen, das nicht besonders schön oder luxuriös war, aber überall lagen und standen Bücher. Diese Bücher waren es, die unserer Wohnung Charme und Wärme gegeben haben und ich bin überzeugt, dass eine solche Umgebung einem sehr viel Mut für das ganze Leben mitgeben kann. Und ja, in der Tat, man sieht sie nicht weinen, man sieht sie sich nicht aufregen. Das ist es, was für mich eben gerade gegen gewisse Klischees geht…
Es handelt sich also eher um ein gebrochenes Klischee?
Gewissermaßen ja: in dem Sinne, dass es bestimmt Menschen gibt, bei denen ein klassisches Drama ausbricht, aber so ist es eben nicht für alle. Ich habe Trennungen erlebt, die viel sanfter aussahen, ganz ohne Aggression, ohne Schreien und Tränen. Oder die Tränen kommen zu einem Moment, in dem man es nicht erwartet. Diese Dinge tragen für mich dazu bei, zu einer ‚wahreren’ Erzählform zu finden, eben gerade weg von den klassischen Klischees.
Kann es auch sein, dass die beiden sich über die Bücher ein Stück weit verloren haben, weil die Beziehung darüber zu rational geworden ist?
Das kann natürlich auch der Fall sein, klar. In jedem Fall weiß oder sieht man nicht, wie die Beziehung vorher aussah. Der Film setzt mit der Trennung ein. Man spürt die große intellektuelle Komplizenschaft der beiden, keiner von beiden ist traumatisiert, was man sich bei so einem Film auch erwarten könnte. Es kann auch einfach sein, dass die beiden sich nicht mehr lieben, man weiß das alles nicht. Aber ich wollte unbedingt nicht, dass es so aussieht, dass sie ihn über alles liebt, während er sie für eine Jüngere verlässt. Diese Dinge passieren immer von beiden Seiten aus.
Subtiler….
Genau. Sie waren 25 Jahre zusammen, haben zwei Kinder, vielleicht ist so eine Geschichte zwischen zwei Menschen auch einfach irgendwann einmal beendet. Und vielleicht ist die Reaktion des Mannes, dass er seine Frau verlässt auch nur die Reaktion darauf, dass vorher schon etwas nicht gestimmt hat oder kaputt gegangen ist oder längst beendet war.
Welche Rolle spielen die geistigen versus die sinnlichen Anteile im Leben Nathalies? Auch hier denke ich wieder an ihre Bücher….
Was ich sagen kann ist, dass es für Nathalie in meinem Film schon genau so ist, dass sie denkt, dass die Bücher bis zu einem gewissen Grad auch eine Leere an anderer Stelle ersetzen können. Das ist bestimmt auch eine Illusion. Da hat der Film eine gewisse Ambivalenz. Wobei Bücher ja nun auch wieder nicht eine Abwesenheit von Sexualität oder Sinnlichkeit bedeuten. Man kann auch beides haben. Wobei es auf der anderen Seite auch einen Teil gibt in dieser Nathalie, die sich versagt oder Dinge in sich verleugnet, nicht wahrhaben will. Sie will ihren Verlust minimalisieren. Der Verlust ihres Mannes zeigt sich aber dann doch an ihrer Beziehung zur Katze.
Man hat tatsächlich das Gefühl, dass sie sich der Katze näher fühlt, als ihrem Mann.
Als ihr Mann sie verlässt, ist es definitiv, sie befindet sich nicht in der Nostalgie, nicht im Bedauern, auch nicht im Versuch, ihn zu halten. Darin liegt schon eine gewisse Kühle. Das kennen bestimmt auch viele Menschen, es ist eine Form sich zu schützen. Einfach so zu gehen, ist an sich eine sehr brutale Form der Trennung.
Sie verliert in kurzer Zeit sehr vieles: ihre Mutter stirbt, ihre Kinder gehen aus dem Haus….
Das ist auch etwas, was ich bei Frauen in einem gewissen Alter beobachtet habe. Sie finden sich auf einmal alleine wieder. Plötzlich kommt es nach einer langen Ehe zu einer Trennung, die Eltern sterben, das gehört wahrscheinlich einfach zu einem gewissen Lebensabschnitt dazu, aber leicht ist das nicht. Ich wollte nicht dass es karikaturesk wirkt. Es ist durchaus eine mögliche Realität, in der man seine Kraft wiederfinden muss. Plötzlich ist da diese Katze, die sie nicht will, die aber alles ist, was ihr noch bleibt. Schließlich nähert sie sich ihr emotional doch an.
Dann heißt diese Katze auch noch ‚Pandora’….
Die Katze drückt etwas aus, was sie nicht in der Form ausdrücken oder zeigen kann oder vermeidet. Auch dass diese Katze schwarz ist,…..diese Katze steht für etwas wichtiges, ganz geheimes, das mit ihren Bedürfnissen zu tun hat, mit alldem, was Nathalie rein äußerlich nicht ist und was sie zu unterdrücken versucht. Tatsächlich geht vieles für mich in dem Film auf den Moment hin – auch wenn es niemals ganz explizit ist – an dem sie die Katze wieder freigibt, vieles löst sich an diesem Punkt. Das hat natürlich auch mit ihren Bedürfnissen zu tun – auch ohne Worte, einfach über die Bilder. Dabei ist es kein Zufall, dass sie kurz vor dieser Szene einen Philosophiekurs im Freien gibt, in dem sie Rousseau zitiert aus der ‚Neuen Heloise’, eine Passage, in der Rousseau erklärt, dass so sehr man auch hofft, glücklich zu sein, und so sehr man sich die Liebe wünscht, man sie doch nur in der Fantasie wahrhaft erleben kann und dass das zwar reicht, aber nicht wirklich befriedigend ist. Da bleibt etwas Frustrierendes zurück. Von alldem handelt es.
Um bei Rousseau zu bleiben: er hat eines DER Erziehungsbücher überhaupt geschrieben, war aber selbst einer der schlechtesten Väter. Gibt es da vielleicht auch eine Parallele, dass Nathalie sehr für sich gelebt hat…
Nathalie hat ihre Kinder nie verlassen und auch keine Bücher über Erziehung geschrieben. Ich denke nicht, dass sie eine schlechte Mutter ist. Aber sie ist tatsächlich eine Philosophin, die vom Geiste Rousseaus geprägt ist und diesen aufgreift. So bin ich auch aufgewachsen. Was meine Mutter so mit Rousseau verbunden hat, war glaube ich insbesondere, seine Art zu schreiben, seine literarische Faser, auch seine Liebe zur Natur. Meine Mutter hat schon immer die Natur und die Tiere geliebt.
Das zeigt sich auch an den sagenhaften Landschaftsaufnahmen im Film…gemäldegleich.
Diese Kombination aus sehr intellektuellen Anteilen auf der einen Seite, und diese enge Verbindung mit der Natur auf der anderen- alles in einer Person-, hat mich schon immer fasziniert.
Es war auch Rousseau, der gesagt hat, der Mensch sei von Natur aus gut, erst die Gesellschaft verändere ihn zum Schlechten….
Ja, es gibt bei Rousseau den Glauben, in dem ich auch aufgewachsen bin und der mich sehr geprägt hat, den ich auch als Filmemacherin vertrete, dass sich in dem Gutsein des Menschen, das auch sehr naiv sein kann, eine metaphysische Wahl zeigt, die man der Welt gegenüber trifft. Ich weiß nicht, ob ich als Filmemacherin einen Film über Menschen machen könnte, die ich grundlegend als schlecht oder böse empfinde. Ich glaube nicht an das Böse/Schlechte. Ich weiß, dass es existiert, ich lese täglich in der Zeitung davon, man ist davon umgeben – nichtsdestotrotz, wenn ich Filme mache, fällt es mir schwer, mich dafür zu interessieren. Ich habe bisher stets Filme über Menschen gedreht, die ich liebe oder geliebt habe – mit all ihren Qualitäten, mit all ihren Fehlern. Aber ich würde niemals einen Film drehen, um etwas Schlechtes über Menschen zu sagen. Das ist ein Verständnis von Kino, das ich nicht habe.
Kann man sagen, dass Ihre Filme tendenziell autobiographisch sind bisher?
Nicht unbedingt autobiographisch, es geht nicht immer um mein eigenes Leben. Von den fünf Filmen, die ich bisher gedreht habe, war nur einer wirklich autobiographisch…
…das war ‚Eine Jugendliebe’…
Genau. Meine anderen Filme sind nicht autobiographisch, aber durchaus sehr von Menschen inspiriert, die ich gekannt und geliebt habe, die ich liebe oder die es manchmal nicht mehr gibt. Ich gehe immer von einem starken Gefühl aus, von einer Leidenschaft, einer Liebe, einer Sympathie, in jedem Fall von einem positiven Gefühl, das ich einzufangen suche.
Was bedeutet es Ihnen zu drehen? Werden Sie sich damit selbst über manche Dinge klar?
Filme machen hat für mich tatsächlich mit dem Wunsch zu tun, mir selbst treu zu bleiben. Es hat für mich viel mit Erinnerung zu tun, ohne mich zu sehr zurückzuwenden. Ich re-kreiere eher eine Erinnerung, die ich auf die Zukunft projiziere. Und plötzlich gibt es dem Leben etwas zyklisches, was ich sehr interessant finde. Für mich hat das mit einer Art Dialektik zu tun, ein wenig bizarr und sehr persönlich zwischen der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft. Eine Art, diese drei in Umlauf zu bringen, in Bewegung zu halten (damit zu jonglieren), so wie in der Gegenwart immer auch die Vergangenheit und die mögliche Zukunft beinhaltet sind. Für mich bedeutet Kino die Vereinigung aller Zeiten in einer Zeit, dadurch habe ich den Eindruck, voll zu leben. In aller Fülle. Kino hat für mich neben der katharsischen Funktion und dem Sinn der Filme immer etwas sehr konkretes an sich, das mit dem Leben zu tun hat, das mit meinem eigenen Leben zu tun hat. Für mich ist es eine Form zu leben, die mich sehr glücklich macht. Ich finde darin ein Gefühl von Erfüllung, das ich nirgendwo anders auf diese Weise empfinde. Das hat mit dem Erschaffen zu tun, aber eben auch mit dem Gefühl alle Zeiten zusammenfallen zu lassen und dem Leben dadurch eine Dichte/Prägnanz zu geben…
In dem Film ‚L’avenir’, was übersetzt ‚Die Zukunft’ heißt, weiß man gerade nicht, wie die Zukunft aussehen wird.
Die Menschen sind von der Zukunft geradezu besessen: die Zukunft des Planeten, die Zukunft Frankreichs, die Zukunft eines Paares, die Zukunft unserer Kinder. Die Zukunft ist geradezu eine weltweite Obsession. Als ich das Skript geschrieben habe, wusste ich nicht sofort, dass das der Titel sein würde.
Für Nathalie ist es schwierig, an die Zukunft zu glauben. Der Film stellt genau diese Frage, die Frage nach einer möglichen Zukunft.
Wie wichtig ist Erfolg für Sie als Filmemacherin, um weiterzumachen?
Mein Publikum ist eher klein, sowohl in Frankreich, als auch im Ausland. Das relativiert die Dinge wieder. Wenn man Filme macht, wenn man versucht, seine Filme zu finanzieren, wird man daran immer wieder erinnert. Ich käme also nie auf die Idee, über mich selbst zu denken: was habe ich doch für einen Erfolg! Ich weiß, dass man das von außen betrachtet denken könnte. Wenn man es aber lebt, wie ich es tue, wenn man versucht, den nächsten Film auf die Beine zu stellen und dann ständig hört: Deine Filme sind schwierig zu verkaufen, das ist kompliziert, dann ist es immer wieder aufs Neue schwierig. Ich bekomme es dann doch immer hin, aber leicht ist es nicht. In alldem stellt sich wahrlich kein Gefühl der Leichtigkeit ein. ‚Eden’, mein Film vor ‚L’avenir’ lief im Kino gar nicht gut, ‚L’avenir’ ließ sich gut finanzieren, weil ich Isabelle Huppert im Boot hatte, aber auch da war der Dreh sehr hart, was den Zeit- und den ökonomischen Druck anging. Es ist immer ein Kampf. Wenn ich van Gogh lese (Sie liest gerade den Briefwechsel zwischen van Gogh und seinem Bruder Theo), denke ich mir, nicht zu fassen, wie sehr er teilweise gelitten hat (und wie viel Glück ich dann doch habe), man kann das gar nicht vergleichen, ich fühle mich winzig wenn ich an van Gogh denke. Er hat so gelitten, er war so wenig anerkannt, die Diskrepanz zwischen seinem Genie und der Abwesenheit von Erfolg, seine finanziellen Schwierigkeiten stehen in keinem Verhältnis, so extrem im Gegensatz zueinander. Wenn ich mir das überlege, hätte ich nie wieder ein Recht, mich überhaupt je zu beschweren. Gleichzeitig denke ich, dass das worauf es ankommt, doch die Hartnäckigkeit ist in der künstlerischen Suche. Als ich angefangen habe, wusste ich nicht, ob mir das jemals gelingen würde, ob meine Filme den Menschen gefallen würden. Deshalb habe ich mich immer sehr an meine eigenen Richtlinien gehalten: ob ein Film funktioniert und gefällt oder nicht, ob die Presse gut oder weniger gut ist, ich habe immer versucht, mich sehr auf meine innere Stimme zu verlassen, mir selbst treu zu bleiben und ehrlich mir selbst gegenüber zu sein. Ich wollte immer und tue es noch heute den Glauben daran bewahren, dass diese Einstellung eines Tages auch Früchte tragen wird. Natürlich genügt die Aufrichtigkeit (sich selbst gegenüber) alleine nicht, um gute Filme zu machen….
Worauf kommt es Ihrer Meinung nach noch besonders an?
…auf Strenge, auf Geduld, es braucht eine Fähigkeit, in sich zu gehen und den Mut, innere Türen, die geschlossen sind, zu öffnen. Das ist Arbeit. Es braucht eine Freiheit im Schreiben und im Umsetzen der eigenen Ideen. Es reicht nicht, ein freies und gutes Drehbuch zu schreiben, die Umsetzung ist mindestens so entscheidend. Und es kommt darauf an, sich seine eigene Freiheit von der Vorbereitung und Finanzierung, übers Casting, während des gesamten Drehs, auch im Schneideraum bis zum Ende hin zu bewahren. All das wiederholt sich bei jedem einzelnen Film. Was ich sagen will ist, dass letztlich der Erfolg eines Filmes vom Drang des Filmemachers abhängt. Es braucht eine unumstößliche Hartnäckigkeit, um sein eigenes Territorium abzustecken und zu verteidigen. Das heißt auch: die Freiheit gegen seine eigenen Dämonen, gegen seine eigenen Zweifel und Ängste und durch sie hindurch aufrechtzuerhalten. Das ist wirklich viel Arbeit und schwierig. Niederlagen nicht als Minderung zu erleben. ‚Eden’ hatte wie gesagt wenig kommerziellen Erfolg, und trotzdem habe ich mich gleich in das nächste Projekt gestürzt, ohne mich mit dem ‚Misserfolg’ – wenn man so will- des vorherigen Filmes zu sehr zu beschäftigen. Ich habe genügend Filmemacher erlebt, die sich von schlechten Kritiken oder Misserfolg entmutigen lassen. So etwas finde ich fatal.
Lesen Sie Kritiken über sich?
Ich entwickele die Tendenz, sie immer weniger zu lesen. Selbst wenn ich im Moment das Glück habe, dass sie ziemlich gut sind, die Kritiken und die Presse im allgemeinen – lese ich eher die Überschriften, ohne zu sehr in die einzelnen Artikel einzutauchen, obwohl ich sehr neugierig bin. Ich habe für mich festgestellt, dass es natürlich unangenehm ist, eine schlechte Kritik über sich selbst zu lesen, aber dass selbst wenn die Kritik gut ist, sie mich destabilisiert. Das rührt mich zu sehr auf und wirft mich in gewisser Weise zurück. Als ‚L’avenir’ so erfolgreich auf der Berlinale lief, war ich schon dabei, an den nächsten Film zu denken und mich damit zu beschäftigen, mich auf die nächste Finanzierung zu konzentrieren. Das heißt nicht, dass mir ‚L’avenir’ nichts mehr bedeutet, ganz im Gegenteil, aber diese Welt ist ausgesprochen zerbrechlich, insbesondere wenn man sich an der Kreuzung zweier Wege befindet. Ich habe Berlin sehr genossen, es sind die tollsten Dinge passiert, sogar die amerikanische Presse war begeistert, aber es war als hätte ich plötzlich Augenschmerzen, all diese Dinge zu lesen.
Eine Art Selbstschutz….
Ja, ich würde es auch als Selbstschutz bezeichnen. Positive Kritiken haben etwas beruhigendes, bringen einen aber künstlerisch nicht unbedingt weiter. Ich begegne Menschen, die kennen meine Filme in und auswendig, tatsächlich macht mir so etwas eher Angst. Da legt sich eine Verantwortung auf meine Schultern, zu viel Druck. Ich habe dann das Gefühl, dass sich all diese Menschen soviel von mir erwarten, so etwas lähmt mich eher.
Diese Erwartungen…
Ich glaube fest daran, dass man, um etwas zu schöpfen und zu erschaffen, all diese Dinge vollkommen vergessen können muss, auch all diese Menschen, die darauf warten, meine nächsten Filme zu analysieren. Mir hilft es, mich auf mich selbst zu besinnen und mich erst mal wieder zurückzuziehen.
Also im Grunde jedes Mal aufs Neue zu beginnen….
Genau, wieder ganz bei null anzufangen. All das ist ein Prozess, sich diese Art der inneren Ausgeglichenheit zu bewahren.
Welche Ängste begleiten Sie denn noch?
Ich habe immer das Gefühl, dass das Schreiben, der Prozess des Schreibens etwas sehr komplexes ist. Bevor ich angefangen habe, Filme zu schreiben, habe ich kleine Dinge für mich geschrieben. Schon damals war ich schnell unzufrieden mit mir selbst. Ich finde, ich schreibe nicht wirklich gut. Wie durch ein Wunder gilt diese Angst nicht für Drehbücher. Wenn ich beispielsweise Briefe an gute Freunde schreibe, was ich durchaus immer wieder tue, wenn auch selten, dann habe ich immer das Gefühl, sie gelängen mir nicht, ich habe so eine Hochachtung vorm Schreiben. Das Drehbuchschreiben ist für mich wie ein freundschaftliches Territorium, das zu mir gehört…
Inwiefern?
Weil ich nicht das Gefühl habe, so literarisch sein zu müssen. Es ist eine Sache in meinem Kopf, die mir das Gefühl gibt, Drehbuchschreiben kann ich meistern, Literatur nicht. Das mag eine Illusion sein. Ich fühle mich sicher im Drehbuchschreiben. Dennoch lässt mich die Angst nicht los, dass sich diese Tür eines Tages schließen könnte, dass sich dieses lähmende Gefühl, meine Ängste, die ich habe, wenn ich denke, ich müsste Literatur schreiben, auch auf mein Drehbuchschreiben übertragen könnten. Vergleichbar mit Jemandem, der eines Morgens nicht mehr aus dem Bett aufstehen kann oder will. Eine Art Depression, mit der genügend Künstler zu kämpfen haben.
Haben Sie eher Angst davor, dass Ihnen nichts mehr einfällt oder dass Sie es nicht mehr ausdrücken können?
Die Inspiration wird mir hoffentlich nie ausgehen, vor Ideen kann ich mich nicht retten und sie erneuern sich ständig. Sogar Ingmar Bergman, der 30 Jahre lang auf den einsamen Färö Inseln gelebt hat, hatte immer Ideen für seine Filme. Ich weiß nicht, ob ich die Inspiration jemals verlieren werde. Wovor ich Angst habe ist, die Worte nicht mehr zu finden. Wie jemand, der Angst hat, sein Augenlicht zu verlieren. Dass ich mich im Ausdruck gehandikapt fühle. Es wird mich immer Mut kosten, mich vor ein weißes Blatt Papier zu setzen, einen Stift zu nehmen. Aber ich tue es, ich weiß, dass ich Geduld haben muss mit mir selbst.
Wie meinen Sie das?
Ich denke immer wieder aufs neue ‚das wird nichts’. Interessanterweise sagt das auch van Gogh: für ihn besteht der Unterschied zwischen wahren Malern und Amateuren, neben den nötigen Fähigkeiten natürlich, darin, dass sich wahre Maler der Angst vor dem weißen Papier jedes Mal aufs Neue stellen und diese überwinden, sie hören nicht auf, sich mit sich selbst zu konfrontieren. Für das Schreiben gilt ähnliches.
Vielleicht geht es auch darum, das Scheitern miteinzubeziehen oder zuzulassen, wie Dürrenmatt schon früh erkannt hat.
Absolut, es geht darum, ein Risiko einzugehen, sich auf den Kampf einzulassen. Es ist Arbeit. Es gibt dabei immer wieder diese Momente, in denen man schreibt und schreibt, und genau weiß, dass es nicht gut ist. Momente, in denen man den Ton nicht findet, in denen man sich trotzdem zwingt, weiterzumachen, selbst wenn hinterher ein großer Teil dessen im Mülleimer landet. Aber am Ende dieser oft mühsamen Arbeit findet sich meist doch etwas Brauchbares. Bisher habe ich alle meine Drehbücher zu Ende geschrieben. Bisher ist es mir stets gelungen, mir durch das Schreiben der Drehbücher die Grundlage für meine Filme zu erschaffen.
Je älter ich werde und je mehr Erfahrung ich habe, desto mehr beruhigen sich diese Ängste. Am Anfang denkt man noch: ‚gut jetzt habe ich einen Film gedreht, schaffe ich einen zweiten oder war das eine einmalige Erfahrung?’ Beim dritten hatte ich diese Ängste auch noch stark denn es gibt genügend Filmemacher, die drei bis vier Filme gemacht haben und dann nichts mehr. Inzwischen habe ich meinen fünften Film geschafft, und ich sage mir: es scheint in mir einen inneren Antrieb zu geben, Filme zu machen. Keine Ahnung, was das ist oder wie das kommt, aber ich gehe offenbar diesen Weg bis zum Ende. Wenn ich einen Film anfange, beende ich ihn auch, zumindest war es bis jetzt so. Warum sollte das also aufhören?
Haben Sie einen speziellen Schreibritus, eine immer gleiche Tageszeit oder sind alle Tage anders?
Ich versuche tatsächlich morgens zu schreiben. Wenn es mir morgens nicht gelingt, dann sieht es schlecht aus. Ich kann auch nachmittags schreiben, aber wenn ich einen Vormittag voller Verabredungen habe und überhaupt nicht zum Schreiben komme wird es schwierig. Als ich noch kein Kind hatte, also bis nach meinem dritten Film, war ich ausgesprochen diszipliniert, was das angeht. Allerdings habe ich auch länger gebraucht. Jetzt habe ich von Natur aus weniger Zeit, es gleicht eher einem Basteln, wann es passt….
Ist es Ihnen schwer gefallen, sich umzustellen?
Es ist mir nicht leicht gefallen, das muss ich zugeben. Davor hatte ich einen Rhythmus und eine Ausgeglichenheit. Wenn man die gar nicht mehr hat, ist das nicht nur schwer, sondern beinahe brutal, sich umzustellen, gerade bei einer so unberechenbaren Sache wie dem Schreiben. Irgendwann habe ich es einfach akzeptiert und mich darauf eingelassen. Jetzt ist meine Tochter schon sechseinhalb Jahre alt und ich kann wieder machen, was ich jetzt tue: drei Wochen hier im Haus von Ingmar Bergman an meinem neuen Drehbuch schreiben. Endlich komme ich dazu. In Paris komme ich manchmal einfach zu gar nichts, da habe ich zu viele Verpflichtungen. Das Leben ist zu konzentriert im Sinne von ‚dicht’. In einer Woche habe ich hier schon mehr geschafft als in einem Jahr in Paris. Das liegt hauptsächlich an der Ruhe, die mich ganz anders konzentrieren lässt und daran, dass ich einfach loslegen kann.
Sehen Sie sich als Künstlerin?
Durchaus. Aber nicht nur, weil ich Filme drehe – auch wenn ich finde, dass Kino absolut eine Form von Kunst ist, wie jede andere Form von Kunst auch. Sondern vielleicht vielmehr in dem Sinne, dass Filmemachen nicht nur als eine Arbeit, als einen Job betrachte, sondern es fließt wirklich alles, was mich ausmacht, darein: meine Entscheidungen, die ich treffe, meine Beziehung zu anderen Menschen, die Natur, wie ich Dinge betrachte, einfach alles. Nichts entkommt diesem Teil meiner Identität. Damit möchte ich nicht behaupten, dass Künstler ein Monopol auf Sensibilität und Betrachtungsweisen haben, gar nicht. Aber für mich ist es etwas, was meine gesamte Existenz beeinflusst.
Sie haben als Schauspielerin begonnen….
Das sagen immer wieder alle, aber ich finde, das stimmt so nicht. Ich habe mit 17 Jahren durch Zufall in einem Film von Olivier Assayas gespielt, hatte aber nie eine Karriere als Schauspielerin. Im Alter von 21 Jahren habe ich meinen ersten Kurzfilm geschrieben. Das war es, was ich wirklich machen wollte.
Sie wollten also nie Schauspielerin sein?
Nein.
Danach haben Sie für Cahiers du Cinema geschrieben…
Das war eine bewusste Entscheidung, weil ich keine Filmhochschule besuchen wollte. Für mich hatte das Kino nie etwas mit einer Schule zu tun. Es ging mir da schon immer um die Freiheit. Ich wollte nicht beigebracht bekommen, wie man eine Location aussucht und die Kamera positionieren muss, ich wollte nicht beurteilt werden und fühlte mich darüber hinaus auch nicht sehr fähig. Ich hatte nicht diese cinephile Kultur. Ich war ein vollkommener Frischling. Ich wollte auf andere Art lernen. Von der Idee der Nouvelle Vague habe ich mich sehr beeinflussen lassen, dass die beste Schule, um Kino zu machen, das Schreiben ist. Für die Cahiers zu schreiben, war für mich eher eine Art, schreiben und betrachten zu lernen, einen Blick aufs Kino zu erlernen.
Würden Sie sagen, dass im Leben Begegnungen entscheidend sind?
Klar. Es hat auch etwas mit Timing und dem Alter zu tun. Wenn man Filmemacher werden will, braucht es den Austausch mit jemandem, der mehr weiß, als man selbst, mit dem man über andere Filme sprechen kann, über das Schreiben, über das Leben. Für mich war dieser Mensch Olivier Assayas. Unser konstanter Dialog hat mich sehr genährt, ich habe unbeschreiblich viel dabei gelernt, auch darüber, was es heißt, Filmemacherin zu sein und zu werden.
Und was bewundern Sie an Ingmar Bergman besonders?
Alles. Die Kohärenz/den Zusammenhang seines Werks, den Weg, den er zurückgelegt hat, von wo aus er gestartet ist und wo er angekommen ist. Das finde ich spannend. Seine Filme sind von unvergleichlichem Einfallsreichtum, sie haben Weite, Komplexität. Gleichzeitig strahlen sie etwas sehr einschüchterndes aus, etwas Unheimliches, etwas Dunkles. Aber auch wenn seine Themen oft mit zerstörerischen Elementen zu tun haben, ganz anders als bei mir, gibt es trotzdem etwas, was mich immer wieder mit seinen Filmen verbindet. Das hat mit der Klarheit seines Schreibstils zu tun. Es beeindruckt mich immer wieder aufs Neue wie seine Charaktere verkörpert sind. Seine Filme zeigen seine Intelligenz, auch eine besondere Art von Schönheit und etwas Faszinierendes. Sie sind nie langweilig. Oft sind sie herb, nicht komisch, sehr wiederholend, und dennoch habe ich mich noch nie gelangweilt. Sie haben alle einen ganz eigenen Rhythmus. Trotz ihrer Strenge. Ich bewundere ihn sehr. Er versteht auch seine Figuren sehr gut, ihr Isoliert-sein. Er selbst hatte ein sehr buntes Leben, er war fünfmal verheiratet, hatte viele Kinder, eine Fülle hinsichtlich seines Lebens. Er ist der Filmemacher, der mich am meisten inspiriert: was seine Filme angeht, aber auch als Mensch. Bei Rohmer, bei Bresson, bei Truffaut finde ich das nicht in diesem Maße.
Was würden Sie sagen, wer heute Ihre Komplizen sind in der Filmwelt? Welche Filmemacher? Wo es keine Chantal Akerman mehr gibt…
Ich habe viele Freunde unter den Filmemachern. Wenn ich von Komplizen spreche, bin ich mir selbst nicht sicher, ob ich von künstlerischen Komplizen spreche oder von Freundschaften? Eben weil ich keine Filmschule besucht habe und alles von Olivier Assayas und anderen Filmemachern gelernt habe, die ich auch durch ihn größtenteils kennengelernt habe. Diese Dialoge und Freundschaften bedeuten mir sehr viel. Das hat mir etwas gefehlt, als ich angefangen habe, weil ich nicht in einer dieser Gruppen war, die sich oft auf Filmhochschulen bilden. Das habe ich also immer sehr zu schätzen gewusst. Ich fühle mich nicht unbedingt zu den Filmen der Regisseure meiner Generation hingezogen, aber zu den Menschen. Es gibt viele, die ich bewundere. Für Claire Denis habe ich beispielsweise viel Bewunderung und Sympathie, auf einer menschlichen Ebene.
Verfolgen Sie das deutsche Kino?
Auf gewisse Weise klar. ‚Alle anderen’ von Maren Ade fand ich großartig. (Sie fängt an, deutsch zu sprechen): ich spreche eigentlich auch deutsch.
Mein Vater ist aus Wien. Ich spreche nicht oft deutsch und schäme mich immer ein bisschen.
Sie sprechen richtig gut….
Nach fünf Minuten werden Sie merken, dass mein Wortschatz sehr klein ist….
Sind Sie zweisprachig aufgewachsen?
Nicht so richtig, aber mitbekommen habe ich schon vieles, ich habe viel deutsch gehört, wir waren oft in Wien, ich habe einige deutsche Freunde, ich habe deutsch in der Schule gelernt. Wenn ich mich konzentriere, kann ich fast alles verstehen. Wenn ich nach Berlin oder Wien fahre, sprechen beinahe alle englisch mit mir nach fünf Minuten, weil es bei mir nicht so schnell wie im Englischen geht. Die Deutschen sprechen so gut englisch, dass sie die Geduld verlieren….deshalb interessiere ich mich natürlich auch für das deutsche Kino.
Dann schauen Sie die Filme auch auf deutsch?
Ja, wobei ich schon immer ein Auge auf der Untertitelung habe, wenn es sie gibt.
Haben Sie ‚Toni Erdmann’ schon gesehen?
Nein, noch nicht, ich war nicht in Cannes. Aber ‚Alle anderen’ mochte ich sehr gerne. Die anderen Filme von Maren Ade kenne ich allerdings nicht. Petzold mag ich gerne, auch wenn ich nur zwei Filme von ihm gesehen habe. Wenn ich auch sehr mag unter den jungen deutschen Filmemachern sind Benjamin Heisenberg und Christoph Hochhäusler. So jetzt genug deutsch gesprochen, das war eine große Anstrengung (lacht). Jetzt bin ich erschöpft. (noch mehr Lachen).
Ihre Filme wirken manchmal wie Dokumentarfilme….
Das habe ich schon ein paarmal gehört. Es ist paradox, weil ich mich selbst kaum für Dokumentarfilme interessiere, um ehrlich zu sein. Ich mache so gerne Filme, weil mich wirklich die Geschichten interessieren. Das ist mir ganz wichtig. Selbst wenn es eine wahre Geschichte wäre, selbst wenn sie sehr viel mit der Realität gemein hätte, dann wäre es doch immer noch eine Geschichte, die man erzählt. Das hat etwas mit der Kindheit zu tun, glaube ich, es hat etwas Kindliches. Ich glaube, ich habe heute noch dasselbe Vergnügen wie als ich ein Kind war, Geschichten zu hören und zu erzählen. Meine Filme haben bestimmt oft viel mit der Realität zu tun, sie wirken realistisch, aber es gibt trotz allem in jeder meiner Geschichten ein Missverhältnis, eine Rekonstruktion, die bei der Wahl ansetzt, was man sagt und zeigt und was nicht. Die Realität ist lückenhaft, chaotisch, auch inkonsistent auf gewisse Weise, sie ist nicht konstruiert. Während Filme eben in eine eigene Form gegossen sind. Bergman zum Beispiel – und es ist schwierig über sein Werk zu sprechen, weil es so umfassend ist – ist ein großes Ganzes, aber aus ganz vielen kleinen Dingen bestehend. In einer Dokumentation, die hier auf den Farö Inseln gedreht wurde, am Ende seines Lebens erzählt er, dass er sehr strikt und diszipliniert war. Die Journalistin fragt ihn: warum. Er antwortet: weil es in ihm so chaotisch aussehe, weil er immer das Gefühl habe, irgendwann verrückt zu werden, sei es für ihn lebensnotwendig, etwas sehr regelmäßiges zu haben, etwas Strenges…das verstehe ich so gut. Diese Mischung aus der inneren Unordnung und der Notwendigkeit des Findens einer äußeren Form ist etwas, womit ich mich sehr identifizieren kann.
Wenn man alle Ihre Filme aneinander reihen würde, hätte man beinahe ein Kaleidoskop der französischen Gesellschaft…
Einerseits ja, andrerseits ist es im Grunde eher ein kleiner Ausschnitt aus der Gesellschaft. In meinen Filmen geht es immer um die bürgerliche Gesellschaft. Um den Mittelstand. Man sieht das Proletariat nicht, genauso wenig wie die Oberschicht oder das gehobene Bürgertum. Es ist vielleicht ein Kaleidoskop aber eines, das immer wieder von derselben bürgerlichen Gesellschaft spricht. Auch das ist eine vielseitige Schicht, aber man sieht weder die Vororte, noch Zuwanderer, und auch keine extrem reichen Menschen. Ich erzähle von dem, was ich kenne. Das ist wie Eric Rohmer. Er hat immer von derselben ‚Sorte Mensch’ erzählt. Ich glaube die Menschlichkeit erschöpft sich nie, auch wenn man immer wieder von derselben Schicht ausgeht, kann man unendlich viel erzählen. Ich könnte nicht künstlich Universen kreieren, die ich nicht kenne, in denen ich mich nicht zuhause fühle. So eine Haltung entspräche mir nicht.
Um nochmal auf ‚L’avenir’ zu sprechen zu kommen: es gibt da auch diesen Konflikt zwischen Mutter und Tochter, also zwischen Nathalie und ihrer Mutter.
Was mich da interessiert hat, und das ist ein bißchen von meiner eigenen Großmutter inspiriert, sind die Gegensätzen der beiden.
Die Tochter ist eine Intellektuelle geworden, während die Großmutter Mannequin war. Sie ist mehr im Körper, in ihrem Auftreten und ihrer Erscheinung verankert. Man könnte sagen, dass die Tochter Professorin für Philosophie geworden ist, war ihre Art sich der Wahl der Mutter entgegenzusetzen. Geist versus Körper sozusagen. Gleichzeitig verbindet die beiden Frauen auch vieles und nicht nur die Tatsache, dass es Mutter und Tochter sind. Sie haben eine große Komplizenschaft untereinander. Das mag vielleicht beinahe schizophren klingen, aber für mich verneint die Rolle von Isabelle Huppert vollkommen das Altern, sie wirkt so jugendlich, gleichzeitig ist es auch ein Teil von ihr selbst. Obwohl sie sehr weiblich und kokett ist. Die Frage nach dem Vergehen der Zeit, diese Angst, die von der Großmutter verkörpert wird, ist eben auch ein Teil ihrer selbst. Ich finde es berührend, dass die Rolle der Großmutter, selbst wenn sie kein Studium absolviert hat, ihre Tochter in dieser Richtung bestärkt. Sie hat also die weibliche Emanzipation ihrer Tochter gefördert. Und auf diese Weise sind die beiden auch miteinander verbunden. Beides sind selbstbewusste, unabhängige Frauen, jede auf ihre Art. Zwei verschiedene Arten die Emanzipation zu leben.
Spannend wäre es zu wissen, wie Nathalie’s Tochter diese beiden Pole vereinen wird…
Das bleibt der Fantasie der Zuschauer überlassen.
Was ich auch interessant fand, war, dass Nathalies Studenten sie sehr bewundern, selbst wenn sie manchmal sehr strikt mit ihrer eigenen Meinung umgeht, diese beinahe den Studenten nahe legen möchte.
Sie hat eine klare Meinung, will aber nicht anderen ihre politische Meinung auf oktroyieren. Am Anfang, als die Arbeiter streiken, weiß man nicht so genau, wie sie darüber denkt. Später mit ihrem ehemaligen Schüler, der nicht mehr ihr Student ist, wird die Beziehung offener, sie sind sich näher. Was ich erzählen wollte ist, welche Kraft sie aus der Jugend zieht. Auch sie gibt ihnen viel: ihr Wissen. Sie nimmt sich Zeit, sie hält ihre Kurse im Park. Das sind alles Dinge, die ich auch bei meiner Mutter erlebt habe. Es ist vor allem die Weitergabe von Wissen, die den Lehrberuf so besonders macht. Die Studenten sind wie viele weitere Kinder. So habe ich das bei meiner Mutter immer empfunden, eine vergrößerte Familie sozusagen. Und dennoch sind es Menschen, die nicht unbedingt viel über ihr Privatleben wissen, es gibt eine Art Scham im Sinne von Berührungsangst -eine ganz wesentliche Grunddistanz. Es ist eine intellektuelle Beziehung, das hat etwas sehr reines an sich. Wenn sie sagt, sie habe ein sehr erfülltes intellektuelles Leben und dass ihr das reiche, dann meint sie damit vielleicht gar nicht in erster Linie die Bücher, sondern eben genau diese menschliche Beziehung zu ihren Studenten.

In einer Szene sagt Nathalies Sohn über ihren ehemaligen Studenten: ‚Das ist der Sohn, den sie gerne gehabt hätte’. Da spürt man eine Art Rivalität…
Absolut. Da ging es mir darum, zu zeigen, dass Nathalies Leben erst sehr groß und weit ist, bevor es sich dann Stück für Stück auftrennt. Man hat das Gefühl, dass sie sich in diesem Moment entscheidet, alles in die Beziehung zu ihrem ehemaligen Lieblingsstudenten zu legen, was natürlich sehr schade ist, weil man als Zuschauer weiß, dass diese Beziehung daran zerbrechen wird. Vielleicht wird sie irgendwann wieder aufgenommen, das weiß man nicht, aber zunächst bleibt sie da hängen.
Jetzt haben wir noch gar nicht über die Musik gesprochen: Brahms, Schumann: das Motiv von Nathalies deutschen Ehemann Heinz. Sie haben oft betont, dass Musik für Sie eine große Rolle spielt. Welche Rolle spielt sie in ‚L’avenir’?
Musik hat in allen meinem Filmen eine große Bedeutung für mich. In ‚L’avenir’ ist das anders. Das kann man oft erst rückblickend betrachtet selbst erkennen. Ich arbeite nicht mit Komponisten zusammen. Das heißt, es gibt immer sehr starke Momente, in denen die Musik in den Vordergrund tritt, es ist aber nie eine Filmmusik. Es gibt also in meinem Filmen immer auch viele Momente der Stille, was wiederum der Musik, die im Film vorkommt eine besondere Stellung und Bedeutung zuweist. Mir ist es wichtig, dass die Musik nicht über die Szenen gelegt wird, sondern aus ihnen heraus entsteht. Die Musik soll von innen kommen. Für mich ist das ein ganz und gar gegensätzlicher Zugang, ein anderes Verständnis von Musik im Film als der übliche Einsatz von Filmmusik. Vielleicht ändert sich das in zukünftigen Filmen, aber bis jetzt bin ich immer so damit umgegangen. Das besondere in ‚L’avenir’ ist, dass sehr wenig Musik darin vorkommt. Im ganzen Film kommen nur vier Stellen mit Musik vor. Der Film dauert ungefähr eine Stunde vierzig Minuten. Es ist beinahe ein Film ohne Musik, die Momente, in denen sie vorkommt, nehmen daher automatisch eine besondere Stellung ein. Sie haben ein anderes Gewicht. In diesem Film ist die Musik von Momenten der Stille umgeben. Das hat auch mit meiner Beziehung zu Musik in meinem eigenen Leben zu tun. Mich beeinflusst Musik sehr. Das hat beinahe schon etwas Heiliges. Ich kann sie nicht anmachen, um irgendwelche Emotionen zu kreieren. Sie muss wirklich eine Bedeutung und einen Sinn haben. Sie soll organisch sein.
Welche Musik hören Sie?
Ich höre alles Mögliche. Wenig klassische Musik, das erinnert mich zu sehr an meine Kindheit, das ist eher schmerzhaft. ‚L’avenir’ ist der erste Film, in dem ich klassische Musik verwendet habe. Heute höre ich Folk, Rock, Elektro. Musik, die ich gerne mag, hat eine so starke Wirkung auf mich, dass sie beinahe wie eine Droge oder hypnotisch wirken kann. Wenn ich ein bestimmtes Stück in einem Film verwende, kann es sein, dass ich dieses Stück zwei Monate rauf und runter höre bis zur Erschöpfung und dann höre ich es gar nicht mehr.
In ‚Paris Match’ haben Sie mal gesagt: ‚Ich habe Angst vor der vergehenden Zeit. Meine Filme helfen mir, mich davon zu kurieren. Ich hatte stets das Gefühl, alt zu sein, dass das Leben hinter mir liegt und ich es nur am Rande erlebt habe. Seit zehn Jahren bin ich dem Leben voraus’. Was hat sich verändert?
Die Tatsache, dass ich fünf Filme realisiert habe. Ein bisschen fühlt es sich an, als hätte ich fünf Kinder bekommen: es ist natürlich nicht dasselbe, geht aber ein wenig in diese Richtung. Mit jedem Film, den ich mache, werde ich sicherer. Manchmal hat es beinahe etwas von Psychotherapie. Die Zerbrechlichkeit, meine Ängste, auch Zweifel sind immer noch da, aber es ist wie eine Festung, eine Schutzmauer, die mich stärker macht. Jeder weitere Film schützt mich noch mehr vor meinen eigenen Ängsten. Bis jetzt habe ich noch nichts Besseres oder Zuverlässigeres gefunden. (lacht) Das hat mit der ‚aktiven Melancholie’ (von van Gogh) zu tun. Diese in etwas zu verwandeln, in etwas kreatives, weg von negativen Gefühlen, vom Tod und von destruktivem. Um die Person zu werden, als die man gemeint ist.
Ganz kurz zu ‚Jugendliebe’. Wie ist es Ihnen gelungen, diese beinahe symbiotische Liebe zu dem jeweiligen Partner zu verändern? Lieben Sie jetzt weniger oder anders?
Ich habe das Gefühl, gemeinsam mit dem Leben diese Art der Beziehung eingegangen zu sein. Das war keine Wahl, sondern ein Gefühl. Das habe ich in meiner Jugend erlebt, bis ich 18 oder 20 Jahre alt war, danach habe ich nicht mehr so geliebt. Es war eine einmalige Erfahrung. Filme machen hat mich zutiefst verändert, es hat mich geheilt. Ich empfinde dabei eine Form von Liebe, die an die Stelle von Selbstzerstörung getreten ist. Ein Teil von mir wird immer so bleiben – ich bin ein Stück weit so vom Wesen. Aber inzwischen bin ich in der Lage einen Teil meiner Liebe in meine Filme zu legen, mich über meine Filme vorm Leben zu schützen. Es wird immer Erlebnisse im Leben geben, die man nicht im Griff hat und von denen man nicht weiß, wie man darauf reagieren wird. Aber ich habe keine Wahl. Ich habe eine solche Liebe im Alter von zwanzig Jahren verloren. Das war ein sehr schmerzhafter Moment. Danach habe ich angefangen, meine Filme zu drehen. Das war wie eine Art, das Leben neu zu erlernen. Wieder zu lernen zu leben. Jetzt muss ich mich hüten, dass das Filme machen nicht zu einer neuen Art Droge wird. Aber selbst dann ist es in meinen Augen eine weniger schmerzhafte Droge, eine fruchtbarere als in einer zu ausschließlichen Art zu lieben.