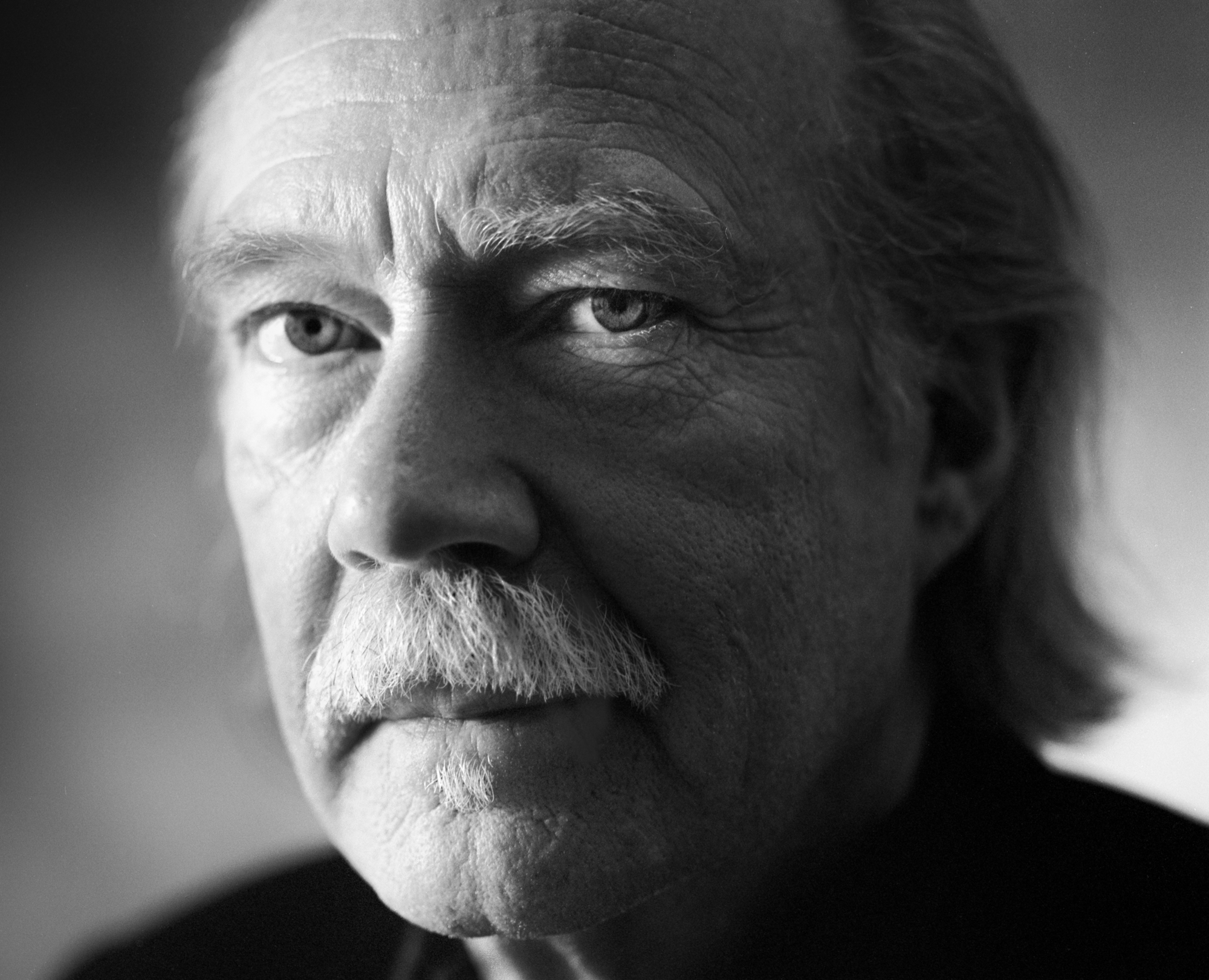Revolver Live! mit dem Kameramann Jürgen Jürges, im Rahmen der Diagonale Graz. Am 07.04.2024, 14 h. Mit Christoph Hochhäusler und Nicolas Wackerbarth.

Werkstattgespräch: Valentin Merz
Petra Palmer: Für Nachtkatzen (De Noche Los Gatos Son Pardos) gab es kein Drehbuch. Wie hast du die Figuren erschaffen und wann hat die Improvisation begonnen?
Valentin Merz: Als Drehvorlage hatten wir eine Wand mit Szenen, die nach Akten geordnet waren. Es gab „Den Film im Film“, „Die Ermittlungen“, „Die Bestatter“ und „Der mexikanische Teil“. Das war mehr oder weniger die Struktur des Films. Das war vorher klar. Dann hatten wir „lose“ Szenen an der Wand, die nicht nach Akten geordnet waren. Manchmal waren es Situationen, manchmal Dialoge und manchmal einfach eine Idee. Anhand dieser Szenen konnten wir dann den Drehplan organisieren. Gerade weil viel improvisiert wurde, war der Drehplan ein sehr wichtiges Werkzeug, um die Narration zu strukturieren und einen Überblick zu behalten. Wir, meine Mini-Crew und ich, hatten also unsere Wand mit Szenen und einen Drehplan. Und als die Schauspieler dazukamen, konnten wir mit etwas Konkretem angefangen.
Insgesamt haben wir sechs Wochen gedreht. Wir begannen mit zwei sehr strukturierten Drehwochen, in denen klar war, was wir machen werden. Auch wenn es innerhalb der Szenen immer Raum für Improvisation gab. In den vier Wochen danach haben wir dann die Geschichte immer wieder angepasst, wir wussten ja nicht so recht, wohin der Film sich entwickeln wird. Das war uns wichtig, auch selbst überrascht zu werden und nicht einfach nur ein Drehbuch umzusetzen.
Wir hatten in dem Sinne keine Figuren. Ich habe die Darsteller, von denen die meisten Laien waren, eingeladen, um vor der Kamera sich selbst zu spielen. Der Kameramann ist vor und hinter der Kamera der Kameramann. Das Gleiche gilt für den Tontechniker, im Grunde genommen alle aus der Crew. Ich bin der Regisseur des Films und im Film spiele ich den Regisseur. Dabei gibt es Dinge, die biografisch sind und Dinge, die fiktionalisiert wurden.
Gast: Wenn du, wie du sagst, noch keine Figuren hattest, wie hast du dann die Leute gecastet? Einige von ihnen sind deine Freund:innen?
Valentin Merz: Für mich war es sehr wichtig, eine Mischung aus Freund:innen und Menschen, die nicht meine Freund:innen sind, zu haben. Sehr wenige der Leute kannten sich davor. Wir wurden dann mit der Zeit mehr zu einer Gruppe. Die meisten meiner Freund:innen kommen aus einer ähnlichen sozialen Schicht mit Privilegien, sie haben studiert, sind Künstler:innen und Intellektuelle, haben europäische Pässe, können sich auf der Welt frei bewegen etc. Es ist mir wichtig, auch mit Leuten zu arbeiten, mit denen ich sonst nicht so einfach die Möglichkeit habe, etwas zu machen. Ich bin an ihrer Lebenserfahrung interessiert, die sie in den Film einbringen können, auch interessieren mich andere Körperlichkeiten, die Art wie man redet und so weiter. Wir haben in Frankreich gedreht, auf dem Land. Das ist eine sehr rurale Gegend, in Frankreich bekannt für die Limousin-Kuh. Einige der Bauern, die bei uns mitspielen, haben vor wenigen Jahren in einer größeren Produktion mitgewirkt, einem Film von Catherine Corsini mit dem Titel Eine Sommerliebe (La Belle Saison). Ein lesbisches Liebesdrama, das in den siebziger Jahren im Landwirtschafts-Millieu spielt. Sie haben einige Bauern aus der Limousin-Region gecastet. Wir bekamen die Casting-Liste von Eine Sommerliebe. Einige der Bauern kannte ich bereits, weil ich viel Zeit in dieser Gegend verbringe. Wir fuhren also herum und gingen von Haus zu Haus und erzählten ihnen von unserem Projekt. Für mich war es eine der schönsten Arbeiten, weil ich dabei auch meine eigenen Vorurteile und Ängste abgebaut habe: Was ist, wenn sie erfahren, dass ich schwul bin und dass es im Film auch um Sexualität geht? Wie bringe ich sie dazu, in einem Film ohne konkrete Geschichte mitzuspielen, die ich ihnen im Voraus verkaufen könnte? Es gibt in dem Film einen sehr schönen Moment, in dem Yannick Chassagne, ein Bauer eben, im Verhör mit dem Inspektor danach gefragt wird, was er denn auf diesem Filmdreh sucht. Er sei für die „expérience cinématographique“ dort, nicht wegen der Geschichte. Und dann macht er sich über den Film lustig und meint, alles was er verstanden hat, sei, dass der Film halt ein bisschen „olé, olé“ ist. Ja halt so erotisch angehaucht, aber von der Geschichte hätte er nichts verstanden. Und die Crew, das scheint ihm eine Bande von Freunden zu sein, die einen kleinen Film drehen. So hat er wohl die Arbeit am Set erlebt. Solche Aussagen fand ich sehr kostbar, ein Geschenk für den Film.
Wir hatten auch zwei Leute aus der Ethical-Porn-Szene dabei, über die wir gestern auch bei der Woche der Kritik gesprochen haben: Natalia Portnoy und Bishop Black. Sie sind Stars in ihrer Community. Ich habe die beiden am Anfang vor allem eingeladen, weil ich mir auch hätte vorstellen können, dass es in dem Film explizitere Szenen gibt, was dann ja nicht der Fall war. Zum Schluss waren sie einfach Teil vom Team, wie alle anderen auch.
Dann haben noch Muxes aus dem Istmo de Tehuantepec, einer Region im Süden von Mexiko, mitgespielt. Die Muxes sind ein drittes Geschlecht in der Kultur der Zapoteken. Es funktioniert nicht im westlichen Queer-Konzept, denn Muxe sind häufig geborene Männer, die sich als Muxes zu erkennen geben und sich dann traditionellen Frauenaufgaben widmen. Was sind traditionelle Frauenrollen? Das bedeutet dort, zu kochen, sich um die Familie zu kümmern, zu stricken und so weiter. Das ist bei uns ja sehr problematisch, so etwas zu sagen. Dennoch hat diese Kultur auch etwas sehr Positives an sich, auch wenn das erstmal bedrückend klingt. Gesellschaftlich sind die Muxes akzeptiert. Sie müssen sich nicht verstecken und werden nicht verfolgt. Und es wird in Tehuantepec gefühlt fast jeden dritten Tag ein grosses Fest gefeiert. Deshalb war es auch wichtig, eine Festszene mit den Muxes im Film zu haben, weil das dort ein so wichtiger Bestandteil des Lebens ist. Ein bedeutender Teil der Wirtschaft dieser Stadt Tehuantepec dreht sich um Feste: Herstellung von Kostümen fürs Fest, Organisation von Essen fürs Fest, Getränke, Anmietung der Infrastruktur, Musik usw. Das Feiern ist ein wesentlicher Bestandteil der Kultur, aber auch der Ökonomie der Stadt.

v.l.n.r: Christophe Schelstraete, Jean Legros, Jean-Charles de Quillacq, Nadège Nouria. Foto: GMfilms
Gast: Wie und wann bist du auf die Idee mit der Detektivgeschichte gekommen?
Valentin Merz: Ich wusste, dass der Regisseur irgendwann verschwinden wird und dass es Genresprünge geben soll, nicht nur einen, sondern mehrere. Gleichzeitig war klar, dass ich keinen klassischen Krimi machen will. Die Polizisten sind die einzigen am Set, die nicht ihre eigene Rolle spielen. Keiner von ihnen ist in seinem Leben ein Polizist. Wir haben sie so gut wie möglich vom Set ferngehalten, so dass ihre Ermittlungen etwas Echtes bekamen. Der Inspektor ermittelt in dem Film nicht zum Verschwinden des Regisseurs. Er versucht vielmehr etwas über die Intimität und die Sexualpraktiken der Figuren herauszubekommen und ermittelt zum Film selbst, die Absichten des Regisseurs, die Dynamiken im Team, deren Identitäten etc. Der Krimi ist ein Instrument zur Exploration und die Beschränktheit der Polizisten, die ist ja selbsterklärend. Gleichzeitig ist die Krimigeschichte der rote Faden, der einen durch den Film führt und einem sagt, dass es etwas zu verfolgen gibt. Es war mehr ein Art Vorwand, um alles in Gang zu halten.
Vincent Maigler: Gestern sprachst du über deine Inszenierung der Verhörszenen, wie du unterschiedliche Informationen an die Polizisten und an die Verhörten gabst, um es zu einer echten Situation werden zu lassen. Hast du diese Methode noch in den anderen Szenen verwendet?
Valentin Merz: Ja, das war etwas, was wir auch bei anderen Szenen gemacht haben. Manchmal wussten die Spielenden nicht, was ihr Gegenüber in der Szene tun wird.
Während sie also spielen, sind sie gezwungen, auf Dinge zu reagieren, auf die sie sich nicht vorbereiten können. Beispielsweise in der Szene, als sie die Leiche des verschwundenen Regisseurs finden, alle herumstehen und darauf warten, dass etwas geschieht. Da haben wir einfach Grüppchen gebildet und einigen Darstellern gesagt, über welche Themen sie sprechen sollen, andere fanden ihre Themen selbst. Unser Ziel war es, eine möglichst reale Situation zu schaffen, die dann lange angedauert hat, ohne dass wir Action und Cut sagen. So sind die Darsteller dann irgendwann mehr sie selbst. Sie verlieren sich in der Szene, sie sind viel mehr einfach da, anstatt auf Kopfdruck etwas zu performen.
Gast: Ihr habt also sehr viel Material von diesen Szenen; wie viel Zeit verbringst du dann mit dem Schnitt?
Valentin Merz: Der Schnitt ist bei den Nachtkatzen ein sehr wichtiger Teil vom „Schreibprozess“. Wir haben sechs Wochen gedreht, dann haben wir eine Pause von drei Monaten gemacht, in der wir geschnitten haben, um dann nochmals zwei Wochen zu drehen. Es ging nicht darum, Retakes zu machen oder die Lücken in der Erzählung zu ergänzen, sondern das gedrehte Material zu formulieren und mir ein mögliches Ende für den Film auszudenken. Bei uns war sowohl der Dreh als auch der Schnitt Teil des Schreibprozesses.
Petra Palmer: Du sagst, es gibt Lücken in der Erzählung, aber das glaube ich gar nicht. Ich denke, es gibt so viele Erzählstränge parallel. Ich habe da nichts vermisst. Wenn ich mich an Filme erinnere, erinnere ich mich oft nicht an den ganzen Film, sondern nur an Szenen. Manchmal weiß ich nicht, wie sie enden, es bleibt einfach ein bestimmtes Gefühl zurück. Die Kriminalgeschichte erinnert an einen Krimi aus den Siebzigern. Dabei besitzt dein ganzer Film für mich eine besondere Nostalgie. Das Licht, die Farben, alles ist wunderschön. Vielleicht kennt ihr Bilities von David Hamilton? Eine Art Soft-Erotik-Film aus den Siebzigern mit einer ähnlichen Atmosphäre.
Die Geschichte der Bestatter steht für mich wiederum völlig unabhängig vom Rest des Films. Sie haben die Aufgabe, die Leiche abzuholen, verirren sich und haben eine Art Befreiungsmoment im Wald. Das war total schön. Ich brauchte dafür keine weitere Erklärung.
Gast: Besitzt in deinem Film die Natur, besonders der Wald, eine magische Kraft?
Valentin Merz: Wahrscheinlich. Die Leute gehen in den Wald und sie verlieren sich darin. Alle werden in gewisser Weise transformiert. Für mich ist es so, als würden sie mit dem Wald zu einer Materie werden, der Regisseur und der Kameramann verschwinden im Wald, sie sterben im Wald. Auch die Bestatter legen sich am Ende auf den Waldboden. Man könnte sich vorstellen, dass sie mit dem Wald eins werden oder dort verwesen wollen, wo sie sich hingelegt haben. Dieser Wald in Limousin stellt für mich einen besonderen Ort dar, frei und weit. Ganz anders als Zürich, wo ich aufgewachsen bin, wo die Menschen auf engem Raum leben, und auch die Orte sehr kontrolliert sind, wo Begegnungsräume meistens Konsumorte sind oder durch den Kapitalfluss bestimmt werden. In Limousin ist es gängig, dass du an einem Tag rausgehst, stundenlang durch die Wälder läufst und einfach niemanden siehst, vielleicht ein Reh, einen Igel oder einen Fuchs. Man befindet sich dort auch weit weg von Gesetz und Staat. Es gibt in Tarnac eine Gruppe von linken Aktivist:innen, die sich „Le Comité invisible“ nennen. In ihrem bekanntesten Buch „Der kommende Aufstand“ („L’insurrection Qui Vient“) vertreten sie radikale und inspirierende Konzepte, wie die Gesellschaft anders organisiert und umstrukturiert werden könnte. Sie wählen diesen Ort, bestimmt nicht nur, weil man billig Häuser kaufen und mieten kann, sondern eben auch, weil man weit weg ist von urbanen Räumen, die sehr stark durchstrukturiert sind. Für mich ist dieser Wald ein Ort, an dem man diese Freiheit spürt. Vielleicht ist es also auch ein Ort, der Raum für neue Ideen zulässt, wie man Dinge anders organisieren könnte. Es ist auch eine Art von Transformationsraum für die Figuren, wie im Märchen, wo der Wald eine mystische Kraft hat.
David Lynchs Serie Twin Peaks hat mich bei der Entwicklung des Films beeinflusst. Die Bäume in unserem Film sind dieselben, die Douglasien. In Twin Peaks ist der Wald auch dieser mystische Ort.

Natalia Portnoy. Foto: GMfilms
Vincent Maigler: Wie verhält sich der Film zur Pornografie? Du sagtest, du hättest es dir anfangs offen gelassen, wie explizit der Film werden würde. Es gibt Sequenzen, in denen wir persiflierte Erotik in Zeitlupe erkennen, im Gegensatz zur gezeigten Intimität in der Erzählung und den Making-of-Elementen. Wir sehen eine besondere Unbefangenheit, ein Auskundschaften. Hast du das beabsichtigt?
Valentin Merz: Die Szenen haben etwas Spielerisches oder Sinnliches. Ich wollte ganz klar verschiedenen Körpern und Sexualpraktiken in dem Film Platz geben. Eine Inspiration dafür war Sweet Sweat von Roee Rosen. Ein Buch, das unter anderem untersucht, was Sexualität sein könnte, und dass sie immer über sich hinausgehen will, das habe ich zumindest für meinen Film so interpretiert. In dem Buch wird auch unter den Achseln gerochen. Ich denke, es wäre wahrscheinlich konsequenter gewesen in dem Film auch explizite Sexszenen zu haben. Aber ich wollte nicht, dass der Film darauf reduziert wird und vor allem auch nicht deswegen als Porno abgestempelt wird, es geht ja darin nicht nur um Sexualität. Jürgen Brüning, der die ersten Bruce-LaBruce-Filme produziert hat, hat mir gestern erzählt, dass es von Hustler White eine Festivalversion gab, das war die Originalversion und da waren explizite Szenen zu sehen. Die haben sie dann aber für einige Länder und für den Kinostart herausgeschnitten. Das hätte für uns auch interessant sein können.
Vincent Maigler: Dein Film hat für mich einen humorvollen, freien Blick auf Erotik und Pornografie. Eine unabhängige Vorstellung davon, was Sexualität alles sein kann, indem er spielerisch und sinnlich ist und sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Ich frage mich, wie explizite Szenen den Film verändert hätten.
Petra Palmer: Es hat mir gerade deshalb so gut gefallen, weil es eine Komödie, eine peinliche, erotische Situation ist, auf seine eigene Art leicht und nicht so gezwungen. Wahrscheinlich hätte es sich sehr verändert.
Valentin Merz: Meinst du, ein Film mit expliziten Sexszenen kann nicht lustig und leicht sein? Ich glaube, das hängt bei diesem Thema auch stark mit der Kultur zusammen. In der Deutsch-Schweiz, die grundsätzlich konservativer ist, würde ich sagen, war das Thema Sex sehr groß. Es hat sehr viel Raum eingenommen. Ich glaube auch, wenn ich explizite Szenen bei der Weltpremiere in Locarno gezeigt hätte, wäre es für viele Zuschauer:innen schockierend gewesen, da saßen über tausend Leute im Saal. Aber in Frankreich bei den Vorführungen wurde ich gefragt: Warum haben Sie keine expliziten Szenen in Ihrem Film? Das ist interessant, finde ich. Gestern waren wir mit einem Freund, einem russischen Filmemacher unterwegs. Ich fragte ihn: Was meinst du, könnte ich meinen Film in Russland zeigen? Er sagte: Nein, niemals, das ist unmöglich. Laut Gesetz darf man dort Homosexualität im Kino nicht mehr zeigen. Der Film lief in Europa auf bedeutenden Filmfestivals, außerhalb von Europa wurde er kaum gezeigt, nur in Brasilien in Sao Paolo und in den USA in Los Angeles.
Gast: Du willst nicht mit Zitaten arbeiten, wie Apichatpong Weerasethakul, dem Wald, den Geistern, diese freie Form etwas zu inszenieren?
Valentin Merz: Natürlich gibt es Einflüsse, aber ich will mich nicht auf Apichatpong beziehen, weil das irgendwie schnell prätentiös wirkt. Der Geist in Uncle Boonmee war eine Inspiration dafür, wie ich den Geist zeigen werde. Auch die Zeitlichkeit in Apichatpong-Filmen ist inspirierend, man hat Zeit. Es ist nicht so sehr eine Frage der narrativen Effizienz. Mein Film hat etwas sehr Intimes und spricht auch über mein Begehren. Wenn man jemanden oder etwas begehrt, dann will man doch auch lange hinschauen. Das, was ich zeige, dient nicht ausschließlich der Narration. Man könnte eigentlich davon ausgehen, dass das selbstverständlich ist, ich bin immer wieder überrascht, wie oft Filme auf logische Geschichten und Figurenpsychologie reduziert werden. Ich denke, dass Apichatpong auch mehr Möglichkeiten im Kino sieht. Ich habe mir Memoria in Mexiko City, in der Cineteca in Coyacan angeschaut. Ich wollte den Film unbedingt sehen, es war die letzte Vorstellung. Ich bin also hin, auch wenn ich mehrere sehr intensive Tage hinter mir hatte und wirklich müde war. Der Film ist zwei Stunden lang und langsam erzählt. Ich bin im Kino eingeschlafen und habe ungefähr 15 Minuten gedöst. Ein „Bumm, Bumm, Bumm“ aus dem Film hat mich wieder aufgeweckt. Es war, als ob meine Träume mit dem Film verschmolzen wären. [lacht] Ich hatte das Gefühl, dass es in Ordnung ist, im Film einzuschlafen, denn dieser Film ist in gewisser Weise hypnotisch. Ich fand es schön, und spürte, dass es kein Problem war einzuschlafen, dass es in diesem Film erlaubt war.
Petra Palmer: Lav Diaz sagt, es ist okay, wenn man bei den Filmen einschläft und wieder aufwacht.
Valentin Merz: Lav Diaz ist radikal, was ich persönlich sehr gut finde. Ich habe seinen Film A Lullaby to the Sorrowful Mystery (Hele sa Hiwagang Hapis) auf der Berlinale gesehen. Das war ein 8-Stunden-Schwarzweiß-Film. Da ist es fast unmöglich nicht einzuschlafen. [lacht]
Petra Palmer: Ich musste wegen dem Tod des Regisseurs an Fassbinders Warnung vor einer heiligen Nutte denken.
Valentin Merz: Ja, in Warnung vor einer heiligen Nutte geht es um einen Fassbinder-Dreh in Spanien. Er spielt einen sehr aggressiven Produktionsleiter. Es gibt einen Regisseur, der wirklich ein Arschloch ist. Alle schreien sich ständig an. Der Film war im Konzept anfangs eine der Referenzen, aber das verschwand dann. Fassbinder ist für mich in meinem Leben sehr wichtig. Ich finde sein Kino unglaublich inspirierend. Ich würde gerne so viele schöne und radikale Filme machen, wie er sie gemacht hat. Man hat ihm ja auch nachgesagt, dass er Deutschlands Balzac war. Das ist schon toll für eine Gesellschaft, wenn jemand Kunstwerke macht, die so direkt zu den Menschen und ihrer Zeit reden.
Gast: Die Erotik-Szenen, ebenso wie die Zombie-Szenen fühlen sich an, als wären die Darstellenden auf eine gewisse Art sehr natürlich und spielerisch lustig. Sie machen sich sogar etwas lächerlich. Welche Rolle spielte Empathie am Set?
Valentin Merz: Ja, Selbstironie war sehr wichtig für die Figuren. Der Film ist ja immer ein bisschen daneben. Gerade weil er sich ein Stück weit über Codes und Klischees lustig macht, nicht ernsthaft ein bestimmtes Genre bedienen will, war es umso wichtiger, dass wir das, was wir machen, ernst nehmen. Als z.B. einer der Schauspieler, der einen Polizisten spielt, den Ton des Films verstand, hat er versucht, den ulkigen Polizisten zu spielen. Dann funktioniert es eben nicht mehr, wenn wir uns über die Figuren lustig machen. Ich habe ihm gesagt, dass er die Situation ganz ernst nehmen muss, auch wenn es erstmal komisch wirkt, einen Traum von jemandem in einer Zeugenbefragung ernst zu nehmen. Nur wenn er den Zeugen seriös nach seinem Traum befragt, kann die Szene möglicherweise komisch werden. Auch ich mache mich lächerlich, wenn ich mich vor der Crew ausziehe. Ich denke, solche Sachen haben sehr zur Enthemmung am Set beigetragen und auch die anderen Darsteller:innen aus ihren Reserven gelockt. Das macht sicher etwas mit der Dynamik und der Hierarchie am Set. Félix Guattari ist ein französischer Philosoph, der in psychiatrischen Einrichtungen den Ansatz verfolgte, dass man zuerst die Institution heilen muss, bevor man die Patient:innen heilen kann. Eine seiner Methoden, um die Einrichtung zu verändern, war, zu sagen, Patient:innen müssten Verantwortung übernehmen. Das psychiatrische Heim soll gemeinsam organisiert werden, die Pfleger:innen und Patient:innen-Rollen möglichst aufgelöst werden. Die Patient:innen kochten also, putzten, führten Theaterstücke auf, haben die Pfleger:innen und Ärzt:innen mit dem Auto von Ort zu Ort chauffiert etc. Ich dachte mir, das könnte auch für ein Filmset ganz interessant sein. Dabei muss man sich dann aber auch darauf einlassen, dass man den Film nicht so sehr kontrollieren kann, wie man das vielleicht gerne möchte. Ob aus so einer Arbeitsweise interessantere Filme entstehen, da bin ich mir nicht sicher, aber ich hoffe, man spürt das dann wenigstens in dem Film, diese gemeinschaftliche Energie und das Spontane und Großzügige, das so ein Dispositiv mit sich bringt.
Gast: In der Partyszene herrscht eine besondere Spannung. Leute flirten miteinander, küssen sich, alles scheint sehr natürlich. Wie wurde die Szene inszeniert?
Valentin Merz: Wir haben uns vorgenommen, wir feiern wirklich eine Party. Dann kam die Frage auf, was wir mit dem Ton machen. Die Idee des Tontechnikers war, einfach einen Beat zu haben, doch zu einem monotonen Beat kann man nicht tanzen. Also beschlossen wir, am Ende einen Song darüberzulegen – so haben wir dann einen Take gemacht, in dem die Leute nur Geräusche gemacht haben, ohne Musik, und sonst lief halt Musik wie auf einer Party. Man hat getrunken, geraucht, getanzt, geflirtet und sich geküsst. Nur der Kuss zwischen den beiden Liebhabern war inszeniert, das war mir wichtig, wegen der Geschichte, um klar zu sagen, der Regisseur ist nicht wegen einem Eifersuchtsdrama verschwunden.

Robin Mognetti. Foto: GMfilms
Vincent Maigler: Wurde diese Szene mit mehreren Kameras gedreht? Wie entstand der eigene Look des Films? Die Vignettierung scheint ja gerade die Referenz zu Lady Chatterley’s Lover zu unterstreichen.
Valentin Merz: Sie wurde aus zwei Winkeln abwechselnd mit einer Kamera gefilmt. Jetzt würde ich diesen Film auf jeden Fall mit zwei Kameras drehen. Man verliert schöne Momente mit nur einer Kamera, besonders wenn improvisiert wird. Mein Kameramann, Robin Mognetti, und ich haben für Brüder – Ein Familienfilm bereits mit einer Blackmagic gearbeitet. Diesmal testeten wir vorher verschiedene, teils sehr lichtstarke Objektive und spezielle Filter, nutzten viel natürliches Licht. Ja, uns gefiel die stellenweise Vignettierung. Die spezielle Farbgebung und Körnung des Films entstand dann im Grading.
Gast: Wie arbeitest du mit den improvisierten Dialogen? Bringt ihr Ideen aus der Probe ein?
Valentin Merz: Ich mag es nicht zu proben. Die Sexszenen waren fast immer One-Takes. Wir haben kurz die Choreografie mit der Kamera abgesprochen, „da küsse ich die Füße, hier auf seinen Mund“ etc. Das hat sehr gut funktioniert. Bei den Verhören haben wir den Darsteller:innen vorher den Kontext skizziert, das Framing war immer dasselbe. Für die Totale haben wir die Kamera eine halbe Stunde lang laufen lassen und die Darsteller:innen hatten freien Lauf. Manchmal habe ich auch reingeredet. Der Der Tontechniker findet das natürlich nicht gut, weil man den Dialog dann nicht verwenden kann. Aber das ist in Ordnung. [lacht] Der musste einfach akzeptieren, dass ich störe. Es war mir wichtiger ins Bild laufen zu können, den Schauspieler:innen, z.B. dem Inspektor, etwas ins Ohr zu flüstern wie: Kannst du den Yannick nach seiner Sexualpraktik befragen? So haben es die Verhörten nicht mitgekriegt. Das hat dann natürlich auch mit ihnen etwas gemacht, was für das Spiel wiederum sehr interessant war. Jean-Charles de Quillacq, der den Inspektor spielt, der war für mich ein Komplize, der mir geholfen hat, die Schauspieler:innen an einen Ort zu führen, den ich interessant fand. Es ist sehr wichtig, Leute im Team zu haben, die auch künstlerisch Mitarbeitende sind, die dir helfen, den Film zu gestalten, weil du auf ihre Ästhetik und Intelligenz vertraust.
Vincent Maigler: Wie war deine Studienzeit in Genf? Hast du dort auch andere Formen von Kunst produziert, andere Felder erforscht?
Valentin Merz: Die Kunsthochschule HEAD in Genf ist eher dokumentarisch orientiert. Sie nennen es da „Cinéma du Réel“, was ein Konzept ist, das man sehr breit interpretieren kann. Dabei sind die Grenzen zwischen Dokumentarfilm und Fiktion fließender, sie können sich gegenseitig durchdringen. Ich würde sagen, dass mir dieser dokumentarische Ansatz sehr geholfen hat, alternative Wege für die Arbeit in der Fiktion zu finden. Bei einem Dokumentarfilm ist es wahrscheinlicher, dass man kein Drehbuch hat, oder dass du viele Stunden Rohmaterial in den Schneideraum bringst. Man formt seinen Film im Schneideraum. Gleichzeitig stellen sich beim Dokumentarfilm ähnliche Inszenierungs-Fragen: Wie erzählt man eine Geschichte, welche Form wählt man, wie leitet man seine Figuren an etc.
Juliane Großheim: Vom ersten Moment an, als Dokumentarfilme gemacht wurden, wurde ja inszeniert. Die Brüder Lumière haben inszeniert. Die Zuschauer:innen denken wirklich ernsthaft, dass ein Dokumentarfilm, oder etwas, das so bezeichnet wird, die Realität abbildet.
Valentin Merz: Ein Film ist immer ein Film. Ein Film kann mir etwas Wahres sagen, auch wenn er nicht vorgibt, die Realität zu filmen oder abzubilden.
Vincent Maigler: Wie hast du den Film finanziert?
Valentin Merz: Ich wusste, dass es nicht möglich sein würde, meinen Film zu vermitteln, bevor er fertig ist. Ich musste also einen Weg finden, um eine flexible Finanzierung zu haben, denn ich konnte diesen Film nicht erklären, bevor er fertig ist. Die Mittel stammen größtenteils aus einem Wettbewerb der Zürcher Filmstiftung, in unserem Fall waren es 220.000 CHF. Drei Projekte pro Jahr können mit diesem Preis gefördert werden. Sie müssen entweder technisch innovativ oder künstlerisch gewagt sein. Um den Preis zu erhalten, reicht ein überzeugendes Konzept aus, man ist nicht gezwungen ein Drehbuch einzureichen, was diese Förderung von allen anderen Förderungen unterscheidet. Ich habe mit meiner eignen Produktionsfirma Andrea Film den Film produziert, das hat auch dazu beigetragen, dass ich ihn so frei machen konnte. Marie Lanne-Chesnot und andere wertvolle Miterarbeiter:innen haben mich bei der Produktion unterstützt, die finanziellen Entscheidungen konnte ich aber sehr souverän treffen. Für die Bild-Postproduktion half uns schließlich das ‚First Look‘-Programm des Filmfestivals Locarno mit 50.000 CHF. Wir zeigten da ein Jahr vor der Weltpremiere in Locarno einen Rohschnitt und gewannen den ersten Preis. Wir hatten Glück. Kurz vor der Premiere hat uns dann das Bundesamt für Kultur noch zusätzliche 50.000 CHF gegeben.
Vincent Maigler: Wie willst du deinen nächsten Dreh angehen?
Valentin Merz: Wir hatten insgesamt acht Wochen, das ist viel, ein langer Dreh. Das war möglich, weil wir eine sehr kleine Crew waren. Es war mir wichtig, Zeit zu haben. Meinen nächsten Dreh möchte ich in kürzerer Zeit machen. Ich möchte im Vorfeld mehr vorbereiten, auch wenn ich unbedingt Platz für improvisierte Momente lassen will. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht einfach das Gleiche reproduzieren sollte, was ich beim letzten Film gemacht habe. In gewisser Weise ist jeder Film für mich wie ein Prototyp.

Robin Mognetti. Foto: GMfilms
Valentin Merz – Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor, Produzent.
Filme: De Noche Los Gatos Son Pardos (2022), Brüder – Ein Familienfilm (2020), Rever comme lui (2020), Chronique d’un territoire (2016), Schauspiel: Unrueh (R: Cyril Schäublin, 2022), Il faut fabriquer ses cadeaux (R: Cyril Schäublin, 2021), Dene wos guet geit (R: Cyril Schäublin, 2017).
Das Gespräch führten Petra Palmer (Filmwissenschaftlerin, Kuratorin, Leitungskollektiv Woche der Kritik), Juliane Großheim (Regisseurin, Drehbuchautorin) und Vincent Maigler (Filmemacher) am 17.2.2023 im Rahmen des Werkstattgesprächs von Valentin Merz an der Universität der Künste Berlin anlässlich des Festivals Woche der Kritik 2023. Transkription: Vincent Maigler, Hannes Brühwiler. Übersetzung aus dem Englischen: Vincent Maigler. Bearbeitung: Vincent Maigler, Istvan Gyöngyösi. Dank an Petra Palmer und Nicolas Wackerbarth.
Titelbild: v.l.n.r: Yannick Chassagne, Mara Thurnheer, Bishop Black, Andoni de la Cruz, Wanda Wylowa. Foto: GMfilms