Revolver Live! mit dem Kameramann Jürgen Jürges, im Rahmen der Diagonale Graz. Am 07.04.2024, 14 h. Mit Christoph Hochhäusler und Nicolas Wackerbarth.
Das Treffen der deutschen Filmclubs, das jedes Jahr in einer kleinen Stadt, abseits allen Traras, stattfindet, ist ziemlich einzig in seiner Art. Zunächst wegen seines internationalen Charakters: es ist viel mehr als eine Begegnung deutscher Filmclubleiter; alle möglichen Leute aus der Branche nehmen daran teil. Man hat hier Flaherty vor seinem Tode gesehen, Paul Rotha, Jacques Becker, Le Chanois, Staudte, Rouquier, Käutner, dieses Jahr Tati. Die Stars kommen nicht zur Parade hin, sondern um zu bestimmten Recherchen beizutragen. Gérard Philippe wurde gesehen, der La beauté du diable vorführte, Howard Vernon verteidigte Le silence de la mer (zwei Filme, deren Sinn und Bedeutung sich in deutscher Umgebung ganz anders ausnehmen). Damit komme ich zur zweiten Charakteristik dieses Treffens: die Publicity spielt hier kaum eine Rolle, Mondänitäten überhaupt keine. Die Meinungsverschiedenheiten können zahlreich sein, aber eins ist gewiß: es finden sich hier nur solche Leute ein, die den Film lieben. Ein guter Film läßt Wogen der Begeisterung im Publikum aufbranden, ein Film, bei dem die Meinungen auseinandergehen, provoziert Handgreiflichkeiten am Ausgang. Niemand glaubt, eine Rolle spielen zu müssen; man ist nicht auf einem Festival; es gibt keinen Preis, kein Markten, keine Einflüsse, wenig Diplomatie. In einem Lande, das uns im übrigen in dieser Hinsicht nicht verwöhnt, ist das eine kleine Insel der Freiheit. Dadurch, daß sie diese Initiative unterstützen und jedes Jahr die Teilnahme französischer Cineasten und Kritiker erleichtern, verdienen das Kultusministerium und das Bureau de Cinéma von Mainz mehr als das übliche Hutschwenken vor den Organisatoren. Albert Tanguy, der das Bureau in Mainz leitet, zeichnet sich gleichfalls durch seine Liebe zum Film aus, und man freut sich, einen Mann zu sehen, in dem Amt und Berufung so genau zusammenstimmen. Verfälsche ich ihrer aller Absichten, wenn ich schreibe, daß Bad Ems dieses Jahr, wie in früheren Jahren Titisee, Bacharach, Lindau, einer der wenigen Orte gewesen ist, wo man den Film weder als Handelsware noch als Propagandainstrument betrachtete, noch auch im Gegenteil als ein ›Harth‹, um das man außer sich gerät, sondern vor allem als ein wunderbares Spielzeug, als die elektrische Eisenbahn von Orson Welles, frivol und ernst, wie Spielzeug sein kann, das dem ›kindlichen‹ Teil in uns entspricht, der bestimmt nicht der am wenigsten tiefe, noch der schlechteste ist.
Dies ist keine Präambel, die das Folgende versüßen soll. Vielmehr ist es im Namen dieser Freundschaft, die uns periodisch an den Ufern des Rheins zusammenführt, im Namen der oft bewunderswerten Arbeit, die die deutschen Filmclubs leisten, und vor allem im Namen der Existenz einer Generation von jungen Cineasten und Kritiker, die die gleiche Luft atmen wie wir, die gleichen Sorgen und die gleiche Unruhe haben wie wir, daß hier ohne Illusionen, aber auch ohne Zögern ein Alarmruf ausgestoßen werden muß: der Film Westdeutschlands geht in einer Sackgasse unter. Vielleicht ist das die Folge eines bornierten Ostrazismus, dessen Opfer die gesamte deutsche Produktion nach diesem Kriege gewesen ist; Tatsache bleibt, daß der westdeutsche Film sich in eine Art moralischen und ästhetischen Ghettos zurückgezogen hat, aus dem man ihn nicht herauskommen sieht. Während in Ostdeutschland ein Stil gesucht und manchmal gefunden wird, zu dem aber Gründe der hohen Politik uns den Zugang versperren (die rituelle Frage: wartet man, bis Staudte tot ist, um in Frankreich Rotation und Der Untertan zu zeigen?), ist es evident, weshalb die Filme des westlichen Teils nicht exportiert werden können. Die regelmäßigen Schlappen, die sie auf den Festivals erleben, illustrieren den traurigen Gag einer in sich selbst versunkenen Produktion, die unfähig ist, ihre Grenzen zu überschreiten, und deren Symbol auf den Vorspannen ein Objektiv sein könnte, das in einen Nabel festgeschraubt wäre.
Es ist hundertmal gesagt worden: 1945 war es normal, daß der deutsche Film beim Expressionismus wieder anknüpfte. Das bewies nur die sterilisierende Wirkung der Hitlerzeit, und irgendwo mußte ja wieder angefangen werden. Aber zehn Jahre später gibt es dafür keine Entschuldigung mehr. Jedermann weiß, daß, seit die deutschen Musiker den Wagnerismus überwunden haben, Wagner Film macht, und daß der Nebel, das Gewitter, das Helldunkel, Tristans Horn und Banquos Geist (ach, das ist nicht mehr Wagner, aber der intelligente Leser …) das Arsenal des deutschen Durchschnittscineasten bilden. Tradition? Verstehen wir uns: es gibt keine einzige nationale Filmkunst mehr, die nicht gleichzeitig Erbin der internationalen Filmkunst wäre, und von einem gewissen deutschen Film insbesondere führen ebensogut Wege zu Shane, wie zu Le rideau cramoisi oder zu Padenie Berlina. Woraus folgt, daß der gegenseitige Austausch nicht funktioniert und daß der deutsche Film mit Qualitätsanspruch (neben dem es natürlich die übliche Produktion gibt, die zu nichts und niemandem verpflichtet ist) ständig nur von sich selbst beeinflußt wird. Die Heirat unter Blutsverwandten erzeugt Verblödung, das ist bekannt. Es ist anormal, daß das ›schöne Foto‹ des deutschen Films des Jahres 1954 noch von dem ›künstlerischen‹ Stil zeugt, der auf dem geometrischen Ort der Postkarte mit Gegenlichteffekt steht, der Dessous aus schwarzer Spitze und des großen Zapfenstreichs. Es ist anormal, daß der Direktor des Fernsehens einem als ›Experimentalfilm‹ eine Version des »Zauberlehrling« zeigt, die sich ohne Schwierigkeit zwischen zwei Rollen der »Nibelungen« einfügen ließe. Es ist anormal, daß ein bedeutender deutscher Produzent einem mit Hoheit lassen bitten »den besten Phantasie-Film des Jahres« ankündigt. Urteilen Sie selbst: Die Großherzogin eines imaginären Großherzogtums im Zentraleuropa um 1900 hat eine Doppelgängerin: eine Operettensängerin. Der Graf, der die Sängerin liebt … Kurz, die typische UFA-Operette, neu aus alten Schachteln entstanden, wie es sich im Jahre 1935 hätte zutragen können. Das Schlimme daran ist nicht, daß der Film schlecht ist – da hat man schon anderes gesehen –, sondern daß er schlecht ist wie ein schlechter Film des Jahres 1935 und nicht wie ein schlechter Film von 1954; daß der Regisseur Paul Verhoeven mit der Inszenierung von Das kalte Herz für die DEFA bewiesen hat, daß er einen interessanten, ungewöhnlichen, einen lebendigen Film machen konnte; und daß etwas Abwegiges in diesem Rückgriff auf erstarrte Formen liegt, ob es sich nun um einen Unter-Erik-Charell beim ›Commercial‹ oder um einen Unter-Caligari beim ›Künstlerischen‹ handelt.
Ein kleiner Unterrichtsfilm zeugt von dieser Regression. Der genannte Paul Verhoeven hatte den lobenswerten Ehrgeiz, die Zuschauer in die »Mittel des Films« einzuweihen, und führte ein und dieselbe Szene vor, die auf verschiedene Weise behandelt war [Variationen über ein Filmthema]. Ein ausgezeichnetes Prinzip, aber so sah es aus: während die Szene in seiner ersten, völlig nüchternen und schlichten Version ohne Schwierigkeiten abläuft, wird sie plumper, peinlicher, weniger überzeugend in dem Maße, in dem die ›filmischen Mittel‹ in Erscheinung treten. Schatten dramatisieren das Treppenhaus, bizarre und unbegründete Winkel erdrücken und deformieren die Figuren; eine indiskrete Musik bläst das ganze auf (nur ein Gegenschuß-Fehler unterlief: man kann nicht an alles denken) – kurz, wir befinden uns mehr oder weniger im ›Film‹, aber in einem völlig angejährten Film. Und wie immer ist man geneigt, Rückschlüsse vom Film zu ziehen und sich zu fragen, ob dieses Deutschland, das rings um uns mit einer Tatkraft und einem gewiß bewundernswerten Dynamismus wieder aufgebaut wird, nicht auch in seiner Bemühung, mehr und mehr deutsch zu sein, ein verjährtes Deutschland ist.
Mitten in dieser konsternierenden Produktion ziehen drei Filme die Aufmerksamkeit an, teils, weil sie sich durch einen anderen Stil abheben, vor allem aber, weil sie sich bemühen, von zeitgenössischen und erwachsenen Sujets zu handeln. Es sind Weg ohne Umkehr von Victor Vicas, 08/15 von Paul May und Die letzte Brücke von Helmut Käutner. Nebenbei ist zu bemerken, daß Vicas aus Rußland stammt und daß Die letzte Brücke eine austro-jugoslawische Koproduktion ist, bei der nur der Regisseur Deutscher ist. Man sieht, daß diese Ausnahmen auf gefährliche Weise die Regel zu bestätigen scheinen.
Weg ohne Umkehr ist antisowjetisch, was in gewissen deutschen Augen alle Fehler aufwiegt. Seine Meriten aber liegen woanders. Denn eine streng objektive Untersuchung des Drehbuchs führt zu dem Schluß, daß man, wenn man eine solche Menge von Unwahrscheinlichkeiten häuft, kaum an sein Sujet glauben kann. Aber was besticht, ist eine Qualität des Bildes und der Inszenierung, an die uns die amerikanischen Produktionen vom gleichen Schlage nicht gewöhnt haben. Vielleicht, weil man diese Arbeit dahinten Laufburschen überläßt (Kazan ist der einzige große Regisseur, der es mit dem ebensowenig durch Realismus glänzendem Man on a Tightrope riskiert hat) … Immerhin steht fest, daß Vicas seinen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten während des Krieges genützt hat, und wenn seine Regie auch eher geschickt als persönlich ist, so läßt sie doch wünschen, daß er sich jetzt einem Sujet zuwendet, das er liebt, wenn es einen solchen Artikel gibt (warten wir seine Adaptierung von »Siegfried« ab). Aber wie merkwürdig ist es doch, daß ein Film, der die Absicht verrät, dem Westen das Monopol der Humanität zuzusprechen, selbst so ganz frei davon ist und daß dieses Plädoyer für den Menschen aussieht wie eine eiskalte und fast abstrakte Stilübung! Es ist sogar ein Gag dabei: der Chef der sowjetischen Polizei, eine Figur, die der Drehbuchautor so angelegt hat, daß sie einen verallgemeinerten antirussischen Affekt provozieren soll, ist dermaßen die Reinkarnation seines Chefs, daß er dessen Portrait auf seinen Schreibtisch vor dem Zuschauer ausbreitet. Künstlerpech: es ist Berija!
08/15 ist sicher der Film, von dem in diesem Jahr am meisten gesprochen wurde. Nach einem Roman von Hans Hellmut Kirst, der eine merkwürdige Ähnlichkeit mit From here to Eternity hat (ich gebe hier lieber nicht den Nonsens wieder, der den französischen Versionen von Buch und Film als Titel dient), für die Leinwand adaptiert von Ernst von Salomon, ist es zunächst eine ziemlich realistische und eindrucksvolle Chronik des Kasernenlebens in der Wehrmacht. Und darin liegt unbezweifelbar ein erster gesunder antimilitaristischer Effekt. Man vergißt bestimmt nicht die Saufszene der Unteroffiziere, die sich auf den Tischen des Kasinos geschlossen die Hosen ausziehen. Aber der Reklameslogan für Buch und Film lautet: »Wie es wirklich war«. Man sieht die Zweideutigkeit der Formel, die ebensosehr Entlarvung wie Heimweh beinhaltet. Natürlich war es ekelhaft, es war brutal, aber das, das war es, was ich erlebt habe, ich, ein deutscher Soldat, und über das man den Schleier des Vergessens und des Tadels gebreitet hat. Jetzt widerfährt mir Gerechtigkeit, indem gezeigt wird, »wie es wirklich war«. In diesem Sinne wird der summarische Antimilitarismus des Films wieder aufgewogen durch eine subtilere und gefährliche Selbstgefälligkeit. Die Männer, die sich in den Figuren wiedererkennen und darüber lachen, ihre Unteroffiziere lächerlich gemacht zu sehen, wie die Generation der Revanche über Courteline lachen konnte, können sie nicht vergessen, daß diese Epoche, die sie verwerfen oder so tun, als ob sie sie verwürfen, die ihrer zwanzig Jahre war. Es muß schwierig sein, einen Mann seine zwanzig Jahre verleugnen zu lassen. Wenn die jüngeren Zuschauer aus 08/15 den Ekel über die Armee ziehen, um so besser. Aber es ist nicht ausgeschlossen, daß ihre Eltern im gleichen Geist in dieses Anti-Wehrmachts-Spektakel gehen, wie die Hamburger abends in die Bierstube »Lili Marleen« gehen und dem Orchester des Afrika-Corps, das draußen mit großen Lettern angekündigt ist, zuhören, das moderne Melodien spielt.
Aber erst das Ende des Films erreicht den Höhepunkt der Ambiguität. Nach dem gleichen Muster wie in From here to Eternity (wenn sich auch zwischendurch die Episode Deborrah Kerr – Burt Lancaster umgekehrt hat, da sich die Frau des Unteroffiziers mit dem Leutnant einläßt: in der deutschen Armee steigt der Ehebruch die hierarchische Leiter aufwärts) läuft das Drehbuch auf die Blamage der bösen Unteroffiziere und die Beförderung guter Soldaten durch das Eingreifen eines allwissenden, über jeden Verdacht erhabenen und großzügigen Kommandeurs hinaus. Worauf sich alle zum Waffenschultern im Kasernenhof einfinden – es fehlt nicht ein Gamaschenknopf –, und das Radio den bevorstehenden Krieg ankündigt. Darauf wechseln der Oberst und der Ex-Korporal Asch, eine sympathische Figur, ein halbes Lächeln. Und während es bei dem Wort »Ende« dunkel wird, hört man eine Kanonade losdonnern. So gibt es drei Taschenspielerkunststücke auf wenigen Metern: die Wende, durch die die sympathischen Opfer militärischer Roheiten sich in der Position der Eroberer Europas befinden, in einer Armee, die von ihren bösen Elementen gereinigt ist und von Weisen gelenkt wird – das Lächeln des Einverständnisses, das sich nach Belieben auf die persönliche Situation der beiden Männer oder auf die Weltsituation beziehen läßt – und die diskrete Evozierung des Kriegs, die man auslegen kann, wie man will. Und zweifellos ist die offizielle Absicht die: diese armen jungen Leute wurden der Schlächterei ausgeliefert. Aber dieser geheime kritische Vorbehalt fällt kaum ins Gewicht gegenüber dem völlig absurden, heterogenen Charakter des hier beschworenen Kriegs, der wie vom Himmel fällt. Hier drängt sich der Vergleich mit From here zu Eternity auf und macht einen weniger ungerecht gegenüber Zinnemanns Film. In diesem wird in der Tat der Krieg angeklagt in seinem absurden Wirken, mit dem er, rückblickend betrachtet, die am besten konzipierten Pläne der Menschen und Mäuse durchkreuzt. Ebenso wie der Tod, nach Malraux, das Leben in Schicksal verwandelt, verwandelt der Krieg hier den Frieden in ein abortiertes Spiel. »Die Zufälle der Armee haben mich hierhingeführt, wo ein japanisches Flugzeug oder die Kugel eines Wachpostens mich in die Ewigkeit schicken können, und nichts von dem, auf das ich versucht habe, mein Leben zu bauen, wird mehr Sinn haben.« Der Krieg wird hier also nicht als Fatalität wegen der ihm immanenten Absurdität denunziert, sondern wegen seiner Macht der Verwandlung, des Hohns. Der Krieg hat keine Eigenexistenz, er ist nur die Krankheit des Friedens. Im deutschen Film hingegen gerät man von einer Welt in die andere. Der Krieg ist ein anderer Planet; in den Krieg gehen heißt, einen Sprung ins Absurde tun, in die Verantwortungslosigkeit – man wird es in Nürnberg bemerken. Wenn Zinnemanns amerikanische Soldaten durch ihren Corpsgeist hindurch das Gefühl haben, daß ihnen ein hassenswerter Krieg aufgezwungen ist, so haben die deutschen Soldaten von Paul May eher Teil an dieser »alten militärischen Weisheit«, von der uns »Der deutsche Soldatenkalender« 1955 folgende Kostprobe gibt: »Keine Fragen . . . Vorwärts, marsch!«
Das größere Verdienst von Helmut Käutner und Norbert Kunze, seinen Drehbuch-Mitautor bei Die letzte Brücke, besteht darin, uns einen Krieg zu zeigen, wo Fragen gestellt werden. Und nach der Skizze, die ich soeben vom zeitgenössischen deutschen Film entworfen habe, wird man verstehen, daß ein Film, der für die menschliche Brüderlichkeit durch und gegen den Krieg plädiert, der eine gültige Darstellung des Lebens der Besatzungssoldaten und der Partisanen gibt und der darüber hinaus auf Effekte verzichtet und seine Sprache aus der von Paisà schöpft, zunächst eine Sympathiebewegung wert ist. Das Thema selbst war sinnvoll und reich: eine deutsche Krankenschwester wird von jugoslawischen Partisanen gefangen, um einen Verwundeten zu pflegen. Während sie wider Willen bei ihnen bleibt, versteht sie schließlich den Sinn ihres Widerstandes. – Unglücklicherweise muß die Eloge hier abbrechen. Aus Gründen des Drehbuchs zunächst. Die Autoren haben sich nicht die Eselsbrücke einer doppelten Liebesgeschichte, einerseits mit einem deutschen Soldaten, andererseits mit einem Partisanen, versagen können, was zu melodramatischen Effekten führt und die ganze Geschichte um sentimentale Züge ziemlich üblen Geschmacks beschwert. Dann aus Gründen der Inszenierung. Selten wird man wieder eine so deutliche Gelegenheit finden zu begreifen, wie sehr der Neorealismus zunächst eine geistige Haltung verkörpert, ehe er eine Summe von verschiedenen formalen Entscheidungen ist. Alles ist hier da: Außenaufnahmen und Drehen in natürlichen Dekors, echte Figuren und, mit Ausnahme der Protagonisten, keine professionellen Schauspieler, bis hin zu dieser schrägen Anpeilung der Situationen, die ihnen ihr Quantum Überraschung oder Unsichtbarkeit läßt und nie das Gefühl aufkommen läßt, daß es ›wie im Kino‹ zugeht. Aber innen fehlt etwas. Es verrät sich explizit in den zu papierenen Dialogen, auf subtilere Weise aber in einem ständigen Auseinanderfallen der Handlung und der Mittel der Inszenierung – etwa so, als hätte Käutner sich, wie es in Hellzapoppin geschieht, im Film vertan und als gelänge es mangels eines wirklichen Anliegens einer Technik, über die er Meister* ist, nicht, ihrerseits ein Sujet zu meistern, das sich ins Vage verirrt. So entgehen wir nicht dem Theatercoup des Menschenopfers. Zwischen ihrem deutschen Bräutigam und ihrem jugoslawischen Geliebten, die sie von jeder Seite der Letzten Brücke rufen (selbst Maria Schell gelingt es nicht, diese Episode vor der Lächerlichkeit zu retten), gibt die arme Krankenschwester, von einer unbekannten Kugel getroffen, den Geist auf. Was können die wirklichen Sträucher, die wirklichen Steine, die wirkliche Brücke, die wirklichen Soldaten einer so theatralischen Situation gegenüber ausrichten? Wo umgekehrt Handlung und Darstellung koinzidieren, bietet uns das zum Beispiel den Kampf auf dem Fluß mit den deutschen Booten und dem Geleitzug der Typhuskranken, der ein Stück für eine Anthologie ist. Was der Letzten Brücke also fehlt, ist der Mut, die Absicht bis zum Ende durchzuführen, auf Künstlichkeiten des Drehbuchs und der Behandlung zu verzichten, die sie letztlich zwischen zwei Stilrichtungen liegen lassen, wie die Heldin zwischen den beiden Lagern. Es läßt sich nicht vermeiden, an Käutners ersten Nachkriegsfilm zu denken, In jenen Tagen, der ebenfalls am Ufer eines Flusses spielte und mit dem Ruf »Illigenborg!« aufhörte, mit dem der Held die Durchquerung begann und bestand. Das war ein Hoffnungsruf, der erste, den wir aus Deutschland der Verwirrung vernahmen. Welche neue Verwirrung, welche Ängste, welche Enttäuschungen hindern einen deutschen Regisseur daran, ihn heute wieder aufzunehmen? Welcher Dämon führt ihn zu diesem, für ein Land, das Symbole so liebt, gefährlichen Symbol einer toten jungen Frau zwischen zwei Welten? Was ist das für eine Grenze, auf der das gekreuzigte Deutschland, um seine Wahl betrogen, agonisiert? Demarkationslinie, Oder-Neiße-Linie, Trennungslinie zwischen Ost und West, Glückslinie, Lebenslinie?
*
Ein Vorwurf ist Käutner trotzdem zu machen: er versteht nicht mit Katzen umzugehen. In Die letzte Brücke oder In jenen Tagen fallen die Katzen, von einem Accessoiristen geworfen, ohne jede Natürlichkeit vom Himmel.
—
Chris Marker: »Adieu au cinéma allemand?« In: »Positif«, No. 12. Paris, 1954. Deutsch von Annemarie Czaschke
Zitiert nach:
Theodor Kotulla (Hrsg.): »Der Film. Manifeste, Gespräche, Dokumente. Band 2: 1945 bis heute«. Piper Verlag, München 1964.
 |
| Chris Marker mit Alain Resnais, 1954. |
Ich habe Namen / Filmtitel verlinkt, die mir heute erklärungsbedürftig schienen. Nicht herausfinden konnte ich, was mit ›Harth‹ gemeint ist.
(Eingestellt von Christoph)
Dieser Beitrag hat 3 Kommentare
Kommentare sind geschlossen.
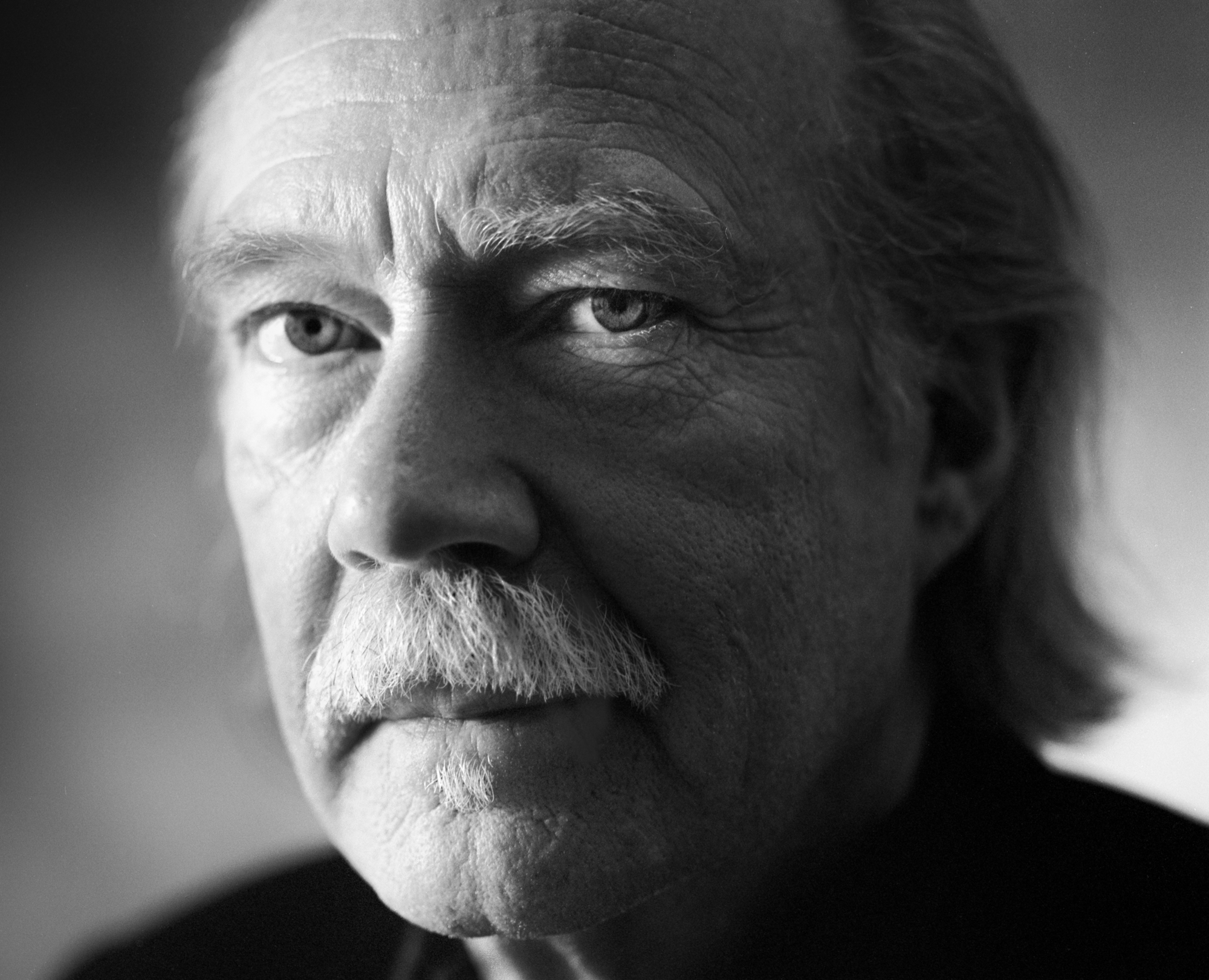


„Harth – represents infinitive compassion” – das könnte sein, ja. Danke für die Nachforschung. Muss damals ja irgendwie allgemein bekannt gewesen sein. The past is a foreign country …
Interessant ist ja auch, dass Kotulla den Band herausgegeben hat. Er ist ja ein bisschen in Vergessenheit geraten als Autor und Regisseur, zu Unrecht, wie ich finde. c
Interessant, dass es Jahre vor "Der deutsche Film kann gar nicht besser sein" schon so einen Kassandra-Ruf gab. Ich hatte bisher noch nichts davon gehört.
Nicht herausfinden konnte ich, was mit ›Harth‹ gemeint ist.
Vielleicht meint Marker das Reiki-Symbol mit diesem Namen (siehe z.B. hier). Dann verstehe ich den Satz zwar immer noch nicht ganz, aber ich hab's auch nicht so mit dem esoterischen Zeugs.