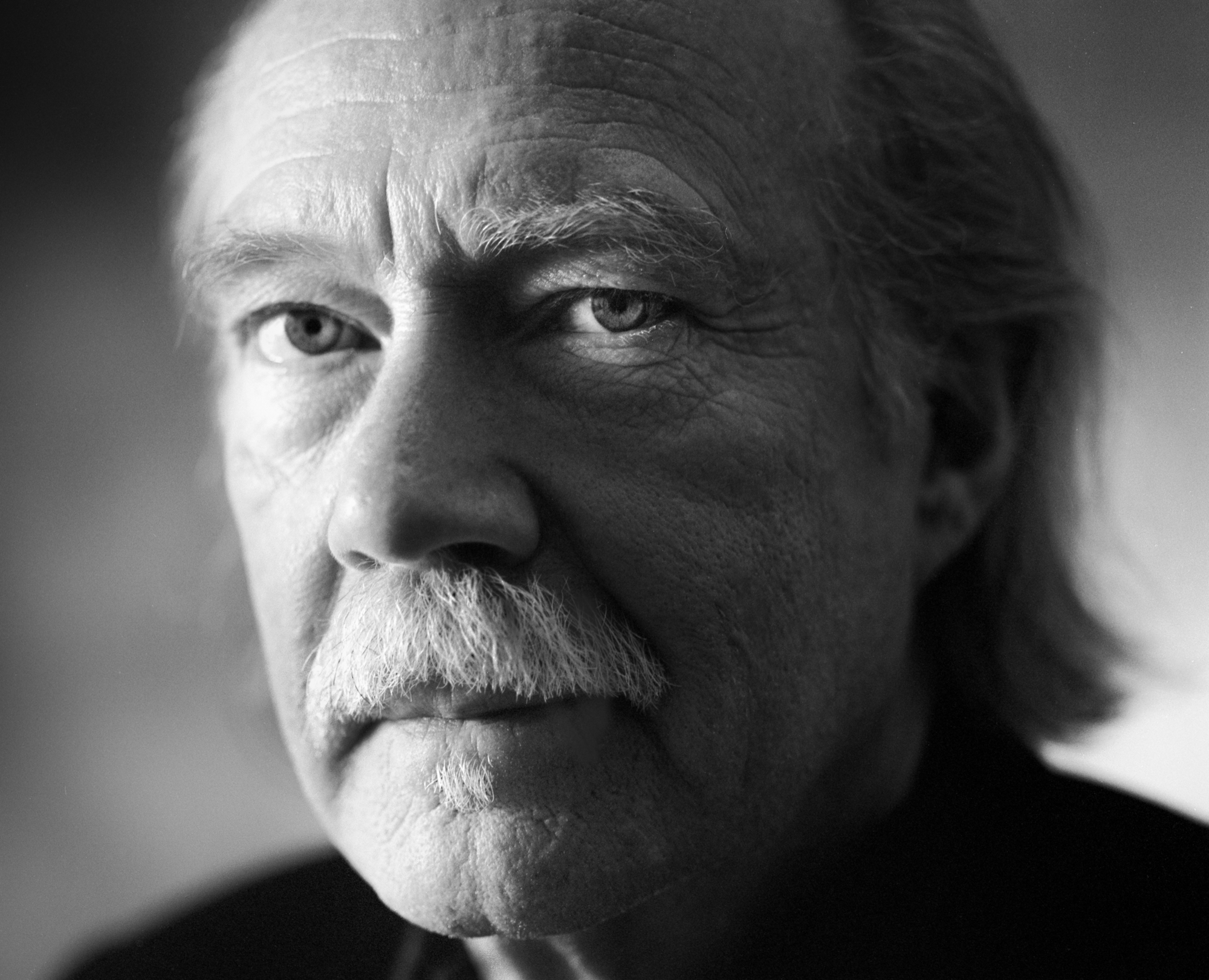Revolver Live! mit dem Kameramann Jürgen Jürges, im Rahmen der Diagonale Graz. Am 07.04.2024, 14 h. Mit Christoph Hochhäusler und Nicolas Wackerbarth.

INTERVIEW IM RAHMEN DER FRANZÖSISCHEN FILMWOCHE IN BERLIN 6.12.2016
Wir stellen das Interview in der Langfassung hier als Extra zu Heft 39 frei zur Verfügung.
Marcus Seibert : 1992 haben Sie eine Art Manifest formuliert: „Wir wollen Schauspieler finden, die mit uns wirklich arbeiten wollen, und die nicht blockiert sind durch ihre Professionalität, Unbekannte, die uns nicht zu irgendwas führen, das uns schon bekannt ist oder anerkannt ist. Gegen den Affekt, gegen den Manierismus, der vorherrscht, arm denken, einfach denken, nackt.“ Eine erste Formulierung der späteren „Methode Dardennes“. Gilt das immer noch?
Luc Dardenne : Das waren unsere Überlegungen, nachdem wir einen wirklich nicht so guten Film gedreht hatten, den wir nicht mochten, aber für den wir verantwortlich waren.
MS : Der hieß Je pense à vous.
LD : Wir wollten danach „bei Null anfangen“. Und es gilt heute noch, dass wir uns auf die Schauspieler konzentrieren, dass wir mit Freunden arbeiten, mit möglichst wenig technischer Vermittlung zwischen uns und den Schauspielern, nicht versuchen „Kino zu machen“, sondern Kinofilme zu drehen, jedes Mal die Wahrheit von dem finden, was wir suchen. Wir haben allerdings zuletzt mit drei bekannten Schauspielerinnen gearbeitet und Olivier Gourmet und Jérémie Rénier sind durch unsere Filme bekannte Schauspieler geworden. Die Herausforderung hat sich also etwas verändert: Wie kann man einen bekannten Schauspieler, einen, den man schon diverse Male in unseren Filmen gesehen hat, noch in diesen „nackten“ Zustand bringen? Und in den langen Proben, die wir vor jedem Dreh machen, versuchen wir sie zu transformieren, sie in den Film fallen zu lassen.
MS : Mit Nacktheit meinen Sie den optimalen Zustand eines unschuldigen Spiels, einer Einfachheit. Wie finden Sie die?
Jean-Pierre Dardenne : Normalerweise antworten wir darauf nicht, weil das ja die Arbeit unserer Proben vor dem Dreh ist. Das ist auch wirklich schwierig zu beantworten, weil jeder Darsteller da anders ist. Wir haben da keine Methode, die wir nur anwenden müssen oder zumindest nicht eine einzige. Wir sind da selbst wie die Ratten im Labyrinth auf der Suche nach Käse.
MS : Aber was machen Sie in den Proben mit den Schauspielern?
JPD : Am ersten Probentag gehen wir die erste Szene des Films durch. Luc und ich, wir haben dann schon den Drehort besichtigt und wir haben schon mal überlegt, wo die Kamera stehen soll, die Darstellerin. Am ersten Probentag für Zwei Tage, eine Nacht haben wir nur die erste Szene geprobt. Sie liegt auf ihrem Sofa. Wir verbringen da sehr viel Zeit mit ihr: Wie liegt sie da? Mit ausgestreckten Beinen oder besser angewinkelt? Hat sie ihren Kopf ins Kissen gedreht? Sieht man nur ihren Pferdeschwanz? Oder hat sie den da noch gar nicht?… So arbeiten wir. Wir gehen von ganz konkreten Situationen aus. Und wenn es Dialog gibt, wird der auch gesprochen.
MS : Ändert der sich in den Proben noch?
LD : Wir streichen vor allem. Wir suchen einen Rhythmus, den wir nur mit den Schauspielern finden können. Und wenn wir den Eindruck haben, hier wäre eigentlich eine Stille besser, dann probieren wir das aus. Und wenn es nicht passt, ändern wir das wieder. Wir proben erst ohne das Team, nur mit den Schauspielern. Aber wenn wir nahe dran sind, dann rufen wir das Team dazu. Wir wissen natürlich, dass zu einem Film eine Kamera, Licht und Mikros gehören, aber die Details müssen die Techniker selber herausfinden. Wir erklären ihnen die Einstellung, was die Kamera machen soll, was die Schauspieler machen. Dann fragen wir: Alles klar? Und wenn alles klar ist, proben wir mit Team und Schauspielern. Wir sitzen dann vor dem Monitor und sehen uns das an. Mit dem Camera-Operator finden wir dann zusammen noch Dinge. Da ist der lichtsetzende Kameramann noch nicht dabei…
JPD : Entscheidend bei den Proben ist, dass wir zu zweit sind. Auch wenn wir da Selbstgespräche führen, wir führen sie laut vor den Schauspielern. Zum Beispiel „Das ist noch nicht, was wir suchen“ oder „ich hab mich geirrt. Das geht nicht.“ Schauspieler, die das zum ersten Mal erleben, denken oft, „Vorsicht, die beiden sind pervers.“ Und vielleicht sind wir das auch ein bisschen, viel mehr sogar, als sie denken. Sie glauben, wir wollen sie nur destabilisieren. Aber wenn sie sehen, dass wir rumprobieren, dann schafft das ein Klima des Vertrauens, das dafür sorgt, dass wir alle, Regie und Schauspieler, unsere vorgefassten Haltungen aufgeben und versuchen, wirklich ganz da zu sein. Das ist das, was wir suchen.
MS : Wenn ihr Ziel dieses Dasein ist, verzichten sie auf Anweisungen, wie zum Beispiel bei Garrel, der seinen Darstellern sagt, sie sollen bestimmte Dinge denken, wenn sie spielen?
LD : Wir sagen niemals einem Darsteller: Denk an dies oder jenes. Nie! Wenn sie uns fragen, was sie dabei denken sollen, antworten wir immer: keine Ahnung. Zum Beispiel Olivier Gourmet in Der Sohn, der ja als DVD bei Ihnen in der Revolver-Edition erschienen ist. Er bringt da dem Jungen, der vor fünf Jahren seinen Sohn getötet hat, das Schreinerhandwerk bei. Der Film spielt damit, dass man nicht weiß, was er mit dem Jungen machen wird. Und er fragte immer wieder: „Aber jetzt will er ihn doch töten, oder?“ Wir haben dann so Sachen gesagt wie: „Warum denn?“ oder „Wir filmen dich eh von hinten, mach dir keine Gedanken.“ Das war natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber nach zwei Wochen Dreh kam er morgens ans Set, drehte uns den Rücken zu und meinte, „ich fang so an, nehm ich an, oder?“ Wir versuchen immer zu destabilisieren und antworten deshalb nie auf solche Fragen. Unsere Anmerkungen sind meistens physisch und verneinend. Also, wenn einer sich umdreht, sagen wir, mach das nicht. Wir wissen nicht genau, was wir wollen, aber wir finden es, indem wir nein sagen.
MS : Die Proben sind also eine Suche nach der richtigen Bewegung, der richtigen Handlung?
LD : Eine Suche nach der Choreographie Körper-Kamera. Wir proben fünf Wochen lang vor dem Dreh mit einer Mini-DV-Kamera. Jeden Abend sehen wir uns an, was wir da gefilmt haben und gucken, ob wir was gefunden haben oder nicht. Die meiste Zeit verbringen wir mit den elementaren Gesten, Körpern, die zu Boden fallen, aufstehen, sich setzen, sich hinlegen. Es geht dabei immer um die Beziehung zum Bildausschnitt. Und weil wir immer an Überraschungen interessiert sind, ist unsere Kamera nie „am richtigen Ort“, damit der Zuschauer den Eindruck hat, das, was wir filmen, leiste Widerstand. Wir laufen oft hinterher, als ob die Körper schneller sind als wir. Oder wir lassen etwas im Off, damit wir es später zeigen können. All das finden wir in den Proben, in denen wir das ganze Drehbuch durchgehen. Ob wir hier das Fenster zeigen wollen oder nicht und in welcher Achse wir das filmen müssen, das klärt sich in den Proben. Und nach diesen fünf Wochen haben wir eine konkrete physische Vorstellung davon, was wir machen wollen und wo die Kamera hin muss.
JPD : Wir sind nicht nur die Ratten im Labyrinth, sondern auch die Kühe, die alles wiederkäuen. Wir haben etwa vier Mägen…
MS : Die üppige Probenarbeit ähnelt den Vorbereitungen eines Theaterstücks. Sie haben eine Theatervergangenheit, ihre Mutter hat viel Theater gespielt. Sie drehen fast alle Szenen als Plansequenzen. Auch das ist gegenüber anderen Filmemachern eine eher theaternahe Drehweise…
JPD : Das liegt daran, dass wir jeden Morgen mit unserer Mutter telefonieren. Aber sie sagt uns beiden immer was anderes [Gelächter]. Nein, das hängt sicher mit unserem Verhältnis zum Theater zusammen, aber andere Filmemacher mit ähnlicher Vergangenheit haben nicht in Plansequenzen gedreht. Wir haben die Technik mit laufender Kamera und offenem Mikro zu inszenieren bei Armand Gatti gelernt. Das ist ein Theatermacher, der vor etwa dreißig Jahren auch hier in Berlin gearbeitet hat. Wir sind aber nicht die einzigen, die mit größeren Zeitblöcken arbeiten. Die Zeitblöcke der Plansequenzen erlauben den Zuschauern, direkt dem beizuwohnen, was sich vor ihren Augen abspielt. Die Zeit des Zuschauens entspricht der der Aufnahme der Handlung. Wenn wir unseren Job gut machen, erlebt er also etwas, wie es sich so vor seinen Augen abspielt. Das gibt einem das Gefühl, dass die Dinge sich gerade ereignen. Manchmal denke ich zwar, wir machen die Dinge so, weil wir das nicht anders können und wir nehmen uns immer wieder vor, nicht in Plansequenzen zu arbeiten, machen es dann aber doch, weil wir immer wieder den Eindruck gewinnen, ohne die Aufnahme der Gegenwart in diesen zeitlichen Blöcken nicht diese Qualität der Gegenwärtigkeit zu erreichen.
LD : Vermutlich filmen wir deshalb auch so oft aus nächster Nähe, weil die Gefahr der Plansequenz darin besteht, dass man die Dinge nur abbildet. Das ist generell die Gefahr des Theaters im Film. Wir brauchen immer Dinge, die im Bild auftauchen und wie Zwischenschnitte wirken. Das ist diese Überraschung, nach der wir in unseren Plansequenzen suchen, die üblicherweise nicht geschnitten werden. Wenn man einen kurzen Zwischenschnitt in eine lange Einstellung schneidet, wie bei Haneke im Film „Liebe“, wo in der Traumsequenz eine Faust aus der Wand kommt, dann zerreißt man damit die Plansequenz. Wir suchen lieber Überraschungen innerhalb der Plansequenzen, den inneren Rhythmus dieser Einstellungen.
MS : Einige Darsteller erleben Ihre Art zu proben und dann in Plansequenzen zu drehen so, dass sie komplett vergessen, was sie da machen und in welchem Film sie sind.
LD : Das ist unser Ziel. Wir sagen immer zu Olivier Gourmet und das klingt jetzt vielleicht wie ein Scherz, ist aber ganz ernst gemeint: Du bist der Schauspieler für fünf Uhr nachmittags. Weil er, wenn wir den ganzen Tag gedreht haben, um diese Uhrzeit nicht mehr weiß, wo er ist und das ist wunderbar, fast automatisch… Wenn ein Darsteller sagt, er habe sich ganz toll gefühlt, ist das immer gefährlich. Ähnlich mit den Kostümen, mit denen wir auch viel herumprobieren. Wenn jemand sagt, „ja, das ist gut“, dann sagen wir immer nein. Damit sich keiner einrichtet in etwas, worin er sich wohlfühlt. Das ist zu seinem Besten.
JPD : Vom ersten Probentag an haben die Darsteller einen Entwurf ihres späteren Kostüms. Wir wissen noch nicht, was es sein wird, aber niemals lassen wir die Darsteller in ihren Alltagsklamotten spielen. Niemals. Und anders, als es gerne mal heißt, sehen wir Gewohnheit nicht als gut an. Es gibt eine Nachbarschaft, eine Gewöhnung oder Nähe zu den Figuren, die von Tag zu Tag wächst, wie im Theater. Aber wenn das Kostüm dann doch nicht passt, wird es ausgetauscht. Das ist eine sehr materielle Arbeit, sehr konkret. Man braucht Intuition, aber die muss sich auch bewähren.
Frage aus dem Publikum : Sie arbeiten immer zusammen. Sind sie immer einer Meinung in ihren Vorlieben und Entscheidungen.
LD : Ja. Wenn wir das einer Frau erzählen, heißt es gewöhnlich, ich glaub euch das nicht. Wenn wir das einem Mann erzählen: mit meinem Bruder wäre das nie möglich.
Nein, natürlich sind wir nicht immer einer Meinung. Zum Glück. Sonst würden wir ja niemals das finden, was wir suchen. Aber wenn er findet, „das wäre irgendwie besser“ würde ich mich nicht hinstellen und sagen „nein, das machen wir nicht.“ Und umgekehrt. Wir probieren herum. Und während des Schnitts, wenn wir uns vor dem wiederfinden, was wir gedreht haben, was uns in dieser Situation am besten erschien, dann wählen wir zusammen mit der Cutterin aus. Vielleicht geht das, weil wir Brüder sind… Ich kenne sonst keine Filmemacher, die wirklich gemeinsam Regie führen. Vielleicht Pressburger und Powells, aber die haben sich irgendwann getrennt. Die Coen-Brüder, aber die sind eben auch Brüder. Wenn wir nicht Brüder wären, weiß ich nicht, ob das gehen würde. Selbst wenn wir nicht die gleiche Vorstellung davon haben, so machen wir doch den gleichen Film. Wir spüren den auf die gleiche Weise. Vielleicht so. Und deshalb bleiben wir offen für die Vorschläge des anderen. Wir denken nicht darüber nach, ob meine Idee toll ist und seine blöd oder ob er mir gesagt hat, meine sei blöd.
Natürlich halten wir manchmal an Dingen fest, wir sind ja Menschen. Man denkt, dieser Drehbucheinfall ist gut, ich schlage ihm das vor und er sagt, nur „ganz ok“. Dann kann es schon mal sein, das mich das ärgert und ich wissen will, warum er nur „ganz ok“ gesagt hat. Und entweder sehe ich das dann ein oder er ruft später an und sagt, ich hab noch eine andere Idee. In Situationen, wo wir nicht einer Meinung sind, fragen wir uns schon mal, verdammt, was machen wir jetzt? Man befürchtet, dass man das Passende nicht findet. Aber bei uns setzt das eine Bewegung, eine Dynamik in Gang, die zu einer Auflösung führt.
MS : Zu der Entstehung ihrer Geschichten. Ich habe gesehen, dass der Titel La fille inconnue zum Beispiel schon 2009 in ihren Notizen auftaucht, die sie als Buch unter dem Titel Au dos de nos images veröffentlicht haben. Es gibt also eine lange „Inkubationszeit“. Sowohl für einen Film als auch für Figuren.
LD : Zuallererst gab es die Figur des Arztes, ein Mann. Und zwar die Rolle von Olivier Gormuet in Der Sohn. Er war da noch Arzt und nicht Schreiner. In der ersten Drehbuchfassung zog er mit seiner Praxis in das Viertel um, wo der Mörder seines Sohnes wohnte, um ihn zu beobachten und in der Hoffung, dass er eines Tages in die Praxis kommt. Dann war es eine Frau. In Der Junge mit dem Fahrrad, war die Friseurin anfangs Ärztin. Sie ist da, um Leute zu versorgen, um den Tod fern zu halten, das Leiden zu lindern. All das macht sie bei dem Jungen, indem sie ihn zu sich nimmt. Aber dann ist die Ärztin doch Friseurin geworden. Dann war der Arzt eher 35-40 Jahre alt, wir dachten an Marion Cotillard. Wir haben versucht, ein Drehbuch zu schreiben und sind damit gescheitert. Es gelang uns nicht, die Patienten vor einer so jungen Ärztin zum Reden zu bringen.
Frage aus dem Publikum : Können Sie erklären, warum aus der Ärztin eine Friseurin geworden ist?
JPD : Ich weiß nicht mehr genau, ob zuerst die Idee mit dem Wasser da war oder ob sie Friseurin geworden ist, weil das mit Wasser zu tun hat. Aber bevor sie Friseurin war, hatte sie einen Zeitschriftenladen mit Tageszeitungen, Bonbons, Zigaretten, Telefonkarten. Sie sollte Kontakt zur Außenwelt haben einen quasi öffentlichen Raum als Arbeitsplatz.
LD : Sie konnte wissen, wer mit dem Fahrrad vorbeifährt, wer das Fahrrad des Jungen gekauft hat. Und es ging um die Szene mit dem Haarewaschbecken, der Schere, weil er sie verletzt. Auf jeden Fall haben wir das eingesetzt und die Friseurin hat uns auf solche Ideen gebracht.
MS : Sie sind ja generell eher vorsichtig mit direkten politischen oder soziologischen Aussagen, aber viele ihrer Filme und auch der letzte beschäftigen sich mit dem, was Bourdieu in seinem Buch „Das Elend der Welt“ genannt hat.
LD (ausweichend) : Jean-Pierre, willst du antworten?
JP : Eigentlich müsste ich dafür erst mal unsere Mutter anrufen [Gelächter]! Aber die isst um die Uhrzeit. Müssen wir uns also selbst mit der Frage rumschlagen… Wir sind deshalb so vorsichtig, weil wir in einer Epoche leben, wo man uns ständig diese blöde Frage stellt, ob wir „engagierte Filmemacher“ sind. Was heißt das? Wir antworten da gewöhnlich mehr so als Provokation, wir engagieren uns für unsere Figuren. Wir hoffen natürlich, dass diese Figuren nicht wie Demonstrationsobjekte rüberkommen. Wir setzen sie jedenfalls nicht so ein. Das heißt nicht, dass wir nichts erzählen. Aber wenn da etwas beim Zuschauer ausgelöst wird, dann durch die Figuren, nicht durch unseren Standpunkt als Filmemacher. Die Begegnung eines Zuschauers mit einem Film – wir reden ja hier von Film – ist eine lebendige Erfahrung, die sich nicht auf eine politische Formel herunterbrechen lässt. Wer das versucht, erleidet meiner Ansicht Schiffbruch.
MS : Als sie aufgehört haben, Dokumentarfilme zu drehen, haben sie gesagt, im Dokumentarfilm könne man sich nicht Phänomenen wie dem Tod annähern. Aber in gewisser Weise ist Ihnen diese Zurückhaltung, den Tod zu zeigen, gelieben.
LD : Es liegt vielleicht daran, dass wir zu zweit sind, aber jedes Mal, wenn wir eine Figur sterben lassen, ist das für uns sehr sehr schwierig, weil die für uns lebendig geworden ist. Ich würde nicht sagen, dass wir uns da wie Mörder fühlen, aber nach allem was wir ihn haben machen lassen, diskutieren wir endlos, manchmal Jahre, aber am Ende des Films haben wir immer noch ein echtes Problem damit.
JPD : Das ist schon komisch. Wir haben nur Jérémie sterben lassen, der im Kino durch uns zum Leben erweckt wurde. Und Amidou. Jérémie hat bei den Dreharbeiten zu Le silence de Lorna eine kleine Party zu seiner Beerdigung veranstaltet… Und ganz gestorben ist er ja auch nicht, weil er in Lornas Bauch weiterlebt. Also ist auch Jérémie nie so ganz gestorben.
LD : Amidou auch nicht, er hat ja auch ein Kind…
MS: Aber sein Tod geschieht im Off.
LD : Ja, wir haben die Tendenz, den Blick der Kamera abzuwenden, den Tod eliptisch zu erzählen. Den Mord am Junkie Claudie in Lorna zeigen wir nicht.
JPD : Wir fragen uns natürlich auch, warum wir seinen Tod nicht filmen. Aber wenn man nicht sieht, wie er getötet wird, dann bleibt der Junge, den man zuletzt auf dem Fahrrad hat wegfahren sehen, wie ein Phantom im Kopf des Zuschauers, er bewohnt weiterhin den Film und hilft Lorna, zu denken oder sich einzubilden und hinterher wirklich dran zu glauben, dass sie schwanger ist.
LD : Wenn man nicht weiß, wo der Körper von jemand abgeblieben ist, der gestorben ist, dann kehrt er zurück, verfolgt einen.
MS : Ich habe in ihren Drehnotizen eine Formulierung über gute Dialoge gefunden, die mir sehr gefällt. Sie setzen dem ein Wittgenstein-Zitat voraus: „Worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen.“ Dann heißt es: „Die Figuren nicht das sagen lassen, was sie nicht sagen können. Sie können nicht aus ihrer Situation heraus, um sie uns mit ihren Worten zu erklären, sie sind in der Situation. Es ist an uns, Worte für sie zu finden, worin sich die Stille der Worte hören lässt, die sie nicht sagen können.“
LD : Ja, diese Stille meint den Körper, der spricht, nicht das artikulierte Wort. Es sind die Worte des Körperlichen die hören lassen, was sie nicht sagen können. Zum Beispiel Rosetta. Wir haben sie als Figur gesehen, die zuschlägt, statt zu reden. Sie leidet sehr, schafft es aber nur manchmal ganz ruhig zu reden. Das ist schwierig für sie. Und sie versteht nicht, dass man sie nicht versteht. Sie regt sich auf, hat Bauchschmerzen. Immer wenn sie keine Arbeit hat, bekommt sie Bauchschmerzen. Man könnte denken, das sind Menstruationsschmerzen, aber vermutlich ist das etwas anderes. Das ist in gewisser Hinsicht eine Hommage ans deutsche Kino, Angst essen Seele auf, der Immigrant, der sich auf dem Boden zusammenkrümmt. Ein toller Film!
MS : Ist diese Art, mit dem Sagbaren umzugehen, die Definition des im Dialog Möglichen, die mir sehr gefällt, ist das eine Folge der Dokumentarfilme, die sie am Anfang gemacht haben? Man trifft ja oft auf Leute, die nicht das sagen, was man gerne hätte, was dann ein Problem für die Filmemacher wird.
JPD : Das stimmt zwar, was Sie da sagen, aber in den meisten unserer Dokumentarfilme sprechen Leute über ihre Erlebnisse in der Vergangenheit. Es geht oft um wichtige Streiks in Belgien oder den Widerstand gegen die Nazis im Raum Lüttich. Wir bringen die Leute an die Orte, wo ihr Kampf stattfand und die an diesen Orten erzählen, was sie damals gemacht haben oder uns das anhand von Gegenständen erklären, die bei ihren Aktionen eine Rolle gespielt haben.
Ich erinnere mich zum Beispiel an einen unserer Protagonisten, der während des zweiten Weltkriegs für die Pressarbeit im Untergrund zuständig war. Er hatte noch diverse Sachen, die er im Krieg versteckt und dann verwahrt hatte, aus seiner Untergrundtätigkeit und hat die benutzt, um uns seine Arbeit zu erklären. Wir haben keine Dokumentarfilme gemacht mit Leuten, die über ihre gegenwärtige Situation gesprochen haben.
MS : Ich habe den Film über den großen Streik von 1960 gesehen, Le bateau, aber Sie haben ja auch in einem Interview für Revolver von den Filmen gesprochen, die sie in ihrem Viertel gedreht haben.
LD : Aber da sprechen auch Leute über ihre Vergangenheit oder eine nicht lange zurückliegende Gegenwart. Aber wir haben nie die Schließung eines Werkes im Moment seiner Schließung gefilmt. Immer erst danach. Wir haben mit den Gewerkschaften zusammengearbeitet anlässlich der Werksschließungen. Wir haben ein Videotape gedreht, wo jeder Arbeiter aus dem Streikkommittee erklärt hat, warum man das Werk nicht schließen solle und wir haben sie gefilmt, wie sie während des Streiks essen. Es war kalt, sie machten sich Feuer. Wir gaben ihnen den Film und sie gaben den an andere Orte, um die Leute für das Thema zu sensibilisieren. Aber wir haben nicht den Beginn des Streiks gefilmt, sondern wie sie über ihre Aktionen sprachen.
MS : Wenn ich mich nicht irre, spielen alle ihre Filme in der Umgebung von Lüttich, in Seraing. Ist der Ort bei Ihnen eigentlich von Anfang an gesetzt oder ist das Ergebnis ihrer Diskussionen?
JPD : Bei La Fille inconnue war zuerst die Hauptfigur und die Praxis. Aber bei Der Junge mit dem Fahrrad hatten wir beispielsweise schon von Anfang an die Stadt, die Arbeiterstadt, die Wohnsiedlung, die Straße und auf der anderen Seite der Straße der Wald und die Tankstelle. Als wir anfingen zu drehen, hatte die Tankstelle dicht gemacht und war in ein Waschsalon umgewandelt worden. Wir haben den Inhaber gebeten, das wieder in eine Tankstelle zu verwandeln. Wir arbeiten mit den Orten, aber manchmal verändern wir sie ein wenig…
MS : Wenn man sich die konkreten Orte ansieht, mit denen sie arbeiten, sind das oft Flussufer, Uferstraßen, Schnellstraßen mit Mauern, man sieht selten den Himmel, aber man sieht Mauern. Sie verallgemeinern diese Orte oft, so wie sie die drehen.
LD : Ja, auch durch die Farben. Grau, rot. Die Drehorte sind für uns sehr grafisch, selbst Fabrikruinen sind sehr grafisch. Weite Einstellungen sind immer gefährlich, weil darin der menschliche Körper hinter der grafischen Gestalt der Orte verschwindet oder in den Hintergrund tritt. Das könnte man als Inszenierungsidee verwenden, aber bei uns ist es im Gegenteil so, dass wir versuchen, uns zu nähern, die Umgebung zu verlieren und ganz bei den Körpern der Darsteller zu sein. In Vietnam hat einer gesagt, ihre Filme stehen nicht für Belgien, weil sie Belgien gar nicht zeigen. Die vietnamesischen Filmemacher sind weitgehend linientreu im Dienste des Regimes – natürlich nicht alle – und sind deshalb der Ansicht, man muss das Land zeigen. Ich verstehe auch, was hinter der Frage steckt. Aber wir wollen eben wirklich keine Landschaft zeigen, sondern die Körper unserer Figuren, ihren Kampf, ihre Wärme, ihren Untergang. Das ist es, was uns interessiert. Gesichter und Körper. Wie sie eingeschlossen sind und wie man einen Film erzählt, der sie befreit und nicht etwa dank Gott, der im Himmel wohnt oder dank des Gesetzes oder der Religion, sondern durch ihre Beziehungen untereinander. Wie kann jemand jemand anderem die Hand reichen? Ich erinnere mich an unseren ersten Film nach eigenem Drehbuch La promesse. Es geht um einen Jungen, dessen Vater Zimmer zu Wucherpreisen an illegale Einwanderer vermietet. Er ist selbst ein ehemaliger Arbeiter, der jetzt arbeitslos ist. Und sein Sohn liebt den Vater, sie sind ein gutes Gespann, aber irgendwann muss er sich von seinem Vater lossagen und ergreift Partei für eine Fremde.
Anfangs hatten wir da eine Figur drin, einen älteren Arbeiter, ein Erbe dieser Solidaritätsbewegung und der Religion. Religion lehrt ja auch Solidarität. Sie lehrt zwar ganz furchtbare Sachen, aber eben auch Solidarität. Wir haben die Figur hinterher wieder rausgeschrieben. Er kann nicht Bescheid wissen und sagen „Dein Vater ist ein Schwein, du musst von ihm weg“, das muss der Junge selbst rausfinden. Er muss spüren, dass diese fremde Frau, im Gegensatz zu dem, was ihm sein Vater gesagt hat und auch im Gegensatz zu seinem eigenen Verhalten im halben Film, wo er ihr immer wieder Geld abnimmt, ein menschliches Wesen ist. Man muss die respektieren und ihr die Wahrheit sagen. Wie kommt man aber dahin, wenn es eben keine Instanz gibt, die einem sagt, wie’s geht? Das ist die Herausforderung im Film. Er geht nicht zur Schule, es gibt also keinen Lehrer, auch keine Mutter, er ist sich und seinen Kumpels überlassen. Es erschien uns zu einfach, diese Figur einzuführen, nur um zu sagen, unsere Charaktere haben keine Tradition.
MS : Könnten Sie eigentlich auch woanders drehen als in Seraing? Oder wollen Sie gar nicht?
JPD : Das ist wie mit der Plansequenz. Das entscheiden wir nicht wirklich, das entscheidet sich. Das ist schon schräg, aber jedes Mal wenn da eine Figur auftaucht oder eine Situation, dann ist es da. Obwohl darunter Filme sind, die von Vermischtes-Meldungen ausgehen wie Der Junge mit dem Fahrrad. Die Geschichte hat man uns in Japan erzählt. Und als wir die Geschichte geändert haben wie im Film, spielte sie dort. Das war wie eine Selbstverständlichkeit für uns. Das hat was von einer Obsession. Und wir haben im Laufe der immer wieder gestellten Frage für uns da eine Antwort gefunden, die indirekt wieder mit unserer Mutter zu tun hat. Wir sind zu zweit, aber diese Stadt ist unser dritter Partner. Das ist die Stadt unserer Kindheit, unserer Jugend, das ist ein Ort, der uns verbindet, den wir teilen. Der erfüllt ist von unseren Erinnerungen, von unseren ersten Erfahrungen als Jugendliche, die Entdeckung des Lebens. All das ist dort, unsere Ängste, unsere Leidenschaften, für uns erzählt diese Stadt all das. Es gibt diese Brutalität oder eher Rohheit, der Mauern, der Unorte, an die sich unsere Figuren nicht ankuscheln können. Oder wenn sie das tun, dann spürt man die Kluft, weil das keine Orte zum Ankuscheln sind. Malraux hat, glaube ich, mal gesagt, ab einem bestimmten Alter ist man verantwortlich für das eigene Mundwerk. Deshalb sage ich jetzt nicht, wir drehen in Seraing, sondern, wir träumen davon, woanders zu drehen…
LD : …aber die Geschichte scheint zu sagen: Das drehen wir in Seraing. Wir haben Mystic River gelesen, den Clint Eastwood verfilmt hat. Wir mochten den Roman sehr und haben gedacht, in Seraing könnten wir den verfilmen.
MS : In Zwei Tage und eine Nacht zeigen Sie kaum „Ruinen“, sondern das bescheiden wohlständige Leben der Arbeiter, das sich in den Jahrzehnten nach den großen Werksschließungen und der großen Depression entwickelt hat. Wie erleben Sie derzeit die Lage in Seraing?
LD : In der Arbeiterklasse gibt es Familien mit zwei Einkommen, denen ein Haus gehört auf den Höhenrücken. Bis in die 60er-Jahre hinein lebten die Arbeiter direkt neben den Fabriken. Und dann haben sie sich irgendwann, wie in allen Konsumgesellschaften ein Auto leisten können, konnten weiter weg wohnen, verstreut in der Umgebung. Das wollten wir zeigen in dem Film.
Man muss schon hinsehen. Die meisten städtischen Orte unserer Filme haben sich verändert mit der Zeit. Außerhalb unserer Filme verändert sich die Stadt. Die Stadtverwaltung ist bemüht, Subventionen zu bekommen, um die Stadt attrakiver zu machen. Zwischenzeitlich war aber die Unterstadt fast verlassen. Es gab nur noch zwei Geschäfte. Und die Schule, auf der wir waren, die hatte zu unserer Zeit 800 Schüler, jetzt nur nach 350 und die Schule war mal eine Gesamtschule und ist jetzt eine Berufsschule mit handfesten Problemen, Schulflucht, Drogen… Das ist wirklich ein Viertel geworden… Und nicht weit weg von der Arztpraxis in La fille inconnue! Das ist nicht das einzige Viertel in der Unterstadt, das Probleme hat. Die versuchen Einiges, die Lage zu ändern, aber dafür braucht man Jobs, Wirtschaftlichsansiedlung, da muss Geld inverstiert werden. Aber das ist nicht unser Job.
Frage aus dem Publikum : Wir haben heute erfahren dass ihre Mutter im Theater gearbeitet hat. Ich würde gerne wissen, hat sie sich mit sozialen Themen beschäftigt? Wie war ihre Erziehung?
LD : Unsere Mutter sang Operetten bei uns im Dorf. Und unser Vater war Industriezeichner. Er hat in einer Firma in der Gegend gearbeitet. Aber seine Leidenschaft, das war ein katholischer Verein, die haben eine Erstaufnahme für Einwanderer gegründet, auch für geschlagene Frauen, für Leute im Dorf, die in Schwierigkeiten geraten waren. Unser Haus war ein offenes Haus. Es gibt eine Menge Sachen, da waren wir nicht einig, aber diese Offenheit gegenüber allen möglichen Leuten, Immigranten oder nicht, da waren wir uns einig. Bei uns waren auch ständig Leute aus dem Dorf und jede Menge Kinder. Es gab da mal eine Situation, Leute die in Schwierigkeiten waren und unser Vater sagte, „dann können die Kinder so lange bei uns wohnen.“ Da waren wir schon etwas eifersüchtig… Ist ja normal.
MS : Das war ein sehr langes Gespräch. Vielen Dank Luc Dardenne und Jean-Pierre Dardenne.
Das Gespräch fand am 6.12.2016 statt in den Räumen des Institut Français Berlin. Dolmetscherin Saskia Walker, Transkription Cécile Tollu-Polonowski, Übersetzung und Bearbeitung Marcus Seibert. Vielen Dank an Anne Vassovières und Emilie Boucheteil.