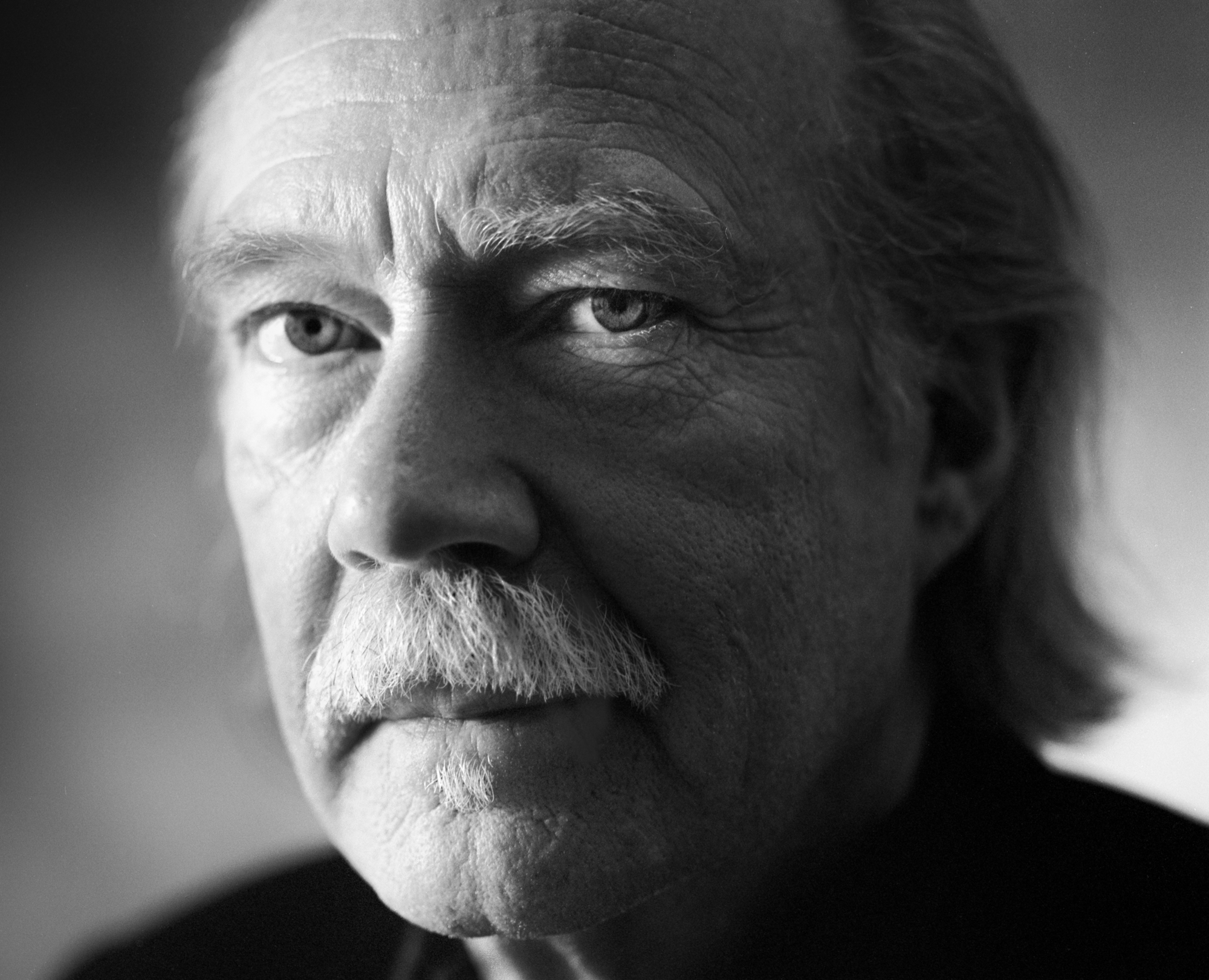Revolver Live! mit dem Kameramann Jürgen Jürges, im Rahmen der Diagonale Graz. Am 07.04.2024, 14 h. Mit Christoph Hochhäusler und Nicolas Wackerbarth.
Auf The Tree of Life und To the Wonder folgt nun Knight of Cups. Ich bin mir nicht sicher, ob man es seinen radikalsten Film nennen kann (und ob solche Zuschreibungen bei Malick nicht sowieso ins Leere laufen), doch mein erster Eindruck war der einer alles durchdringenden Intensivierung: die Erzählung findet als narratives Rauschen im Hintergrund statt, die assoziative Montage lässt Erlebnisse der Figuren, Träume und Erinnerungen ineinander zusammenfallen, jegliches Zeitgefühl wird weitgehend nivelliert. Momente der Ruhe gibt es kaum.
Das erste Kristallgitter, auf dem sich der Film aufspannt, ist eine lose Erzählung in dessen Mittelpunkt ein erfolgreicher Drehbuchautor steht. Rick lebt in Los Angeles und ist beliebt, bei Produzenten und Frauen. Doch eine profunde Leere hat sich in ihm ausgebreitet, an der auch der Luxus mit all seinen Exzessen nichts ändert. Weitere Figuren gleiten in und aus dem Film, sein Bruder, sein Vater, verschiedene Frauen.
Das zweite Gitter ist entscheidender: Los Angeles (und etwas später Las Vegas). Gleich zu Beginn schwebt die Kamera über der Erde. Sie nimmt dabei die Perspektive eines Satelliten ein, dessen Antennen leicht ins Bild ragen. Die kosmische Sicht (wie in The Tree of Life) wird hier durch eine technische ergänzt. Von diesem Satelliten geht es dann schnurstracks in das heutige Los Angeles über. Aus der City of Angels wird eine City of Lights. Das strahlende Blau des Himmels, das Sonnenlicht und die Neonlichter der Nacht. Wie eine Drohne ist die Kamera stets in Bewegung und immer nah am Geschehen. Und mittendrin befindet sich Christian Bale. Er spricht kaum und scheint sich noch weniger zu bewegen. Noch deutlicher als in den vorhergehenden Filmen unterläuft Malick das klassische Verständnis von einem Schauspieler. Bale ist hier nicht in erster Linie eine Figur, an der sich die Zuschauer orientieren sollen, sondern vielmehr funktioniert sein Körper als ein Anker, an dem sich die Kamera festhält und der dem Bild Stabilität verleiht.
Kann man Knight of Cups vielleicht am besten als einen Dokumentarfilm verstehen? Nicht im üblichen Sinne. Doch es drängt sich der Eindruck auf (zumindest in diesem Film), dass das wirkliche Interesse von Malick hier liegt. Er erschafft einen fiktionalen Rahmen, legt die Drehorte fest und spricht mit seinen Schauspielern über deren Rollen. Doch dann konzentriert er sich in den einzelnen Szenen oft auf kleine Details, die in diesem fiktionalen Rahmen entstehen. Wie das Licht sich im Wasser bricht zum Beispiel oder das Zusammenspiel von Laien- und professionellen Schauspielern. Und immer wieder verlässt er seine Figuren und dokumentiert das Stadtleben. In diesen sich zwischen Dokumentar- und Spielfilm öffnenden Zwischenräumen scheint mir die besondere Schönheit von Malicks letzten Filmen zu liegen.
Ein Bild sei hier noch erwähnt. Die Kamera befindet sich unter Wasser, langsam sinkt ein Ball und ein Hund taucht nach ihm. Mit offener Schnauze versucht er ihn zu schnappen, doch der Ball entgleitet ihm. Dann taucht der nächste Hund. Den Ball erwischt auch er nicht. Es sind mysteriöse Bilder, die wir da auf der Leinwand sehen, vertraut und fremd. Würde man alle Bilder der insgesamt 441 Filme der diesjährigen Berlinale übereinander legen, so blieben die tauchenden Hunde.
(Hannes)