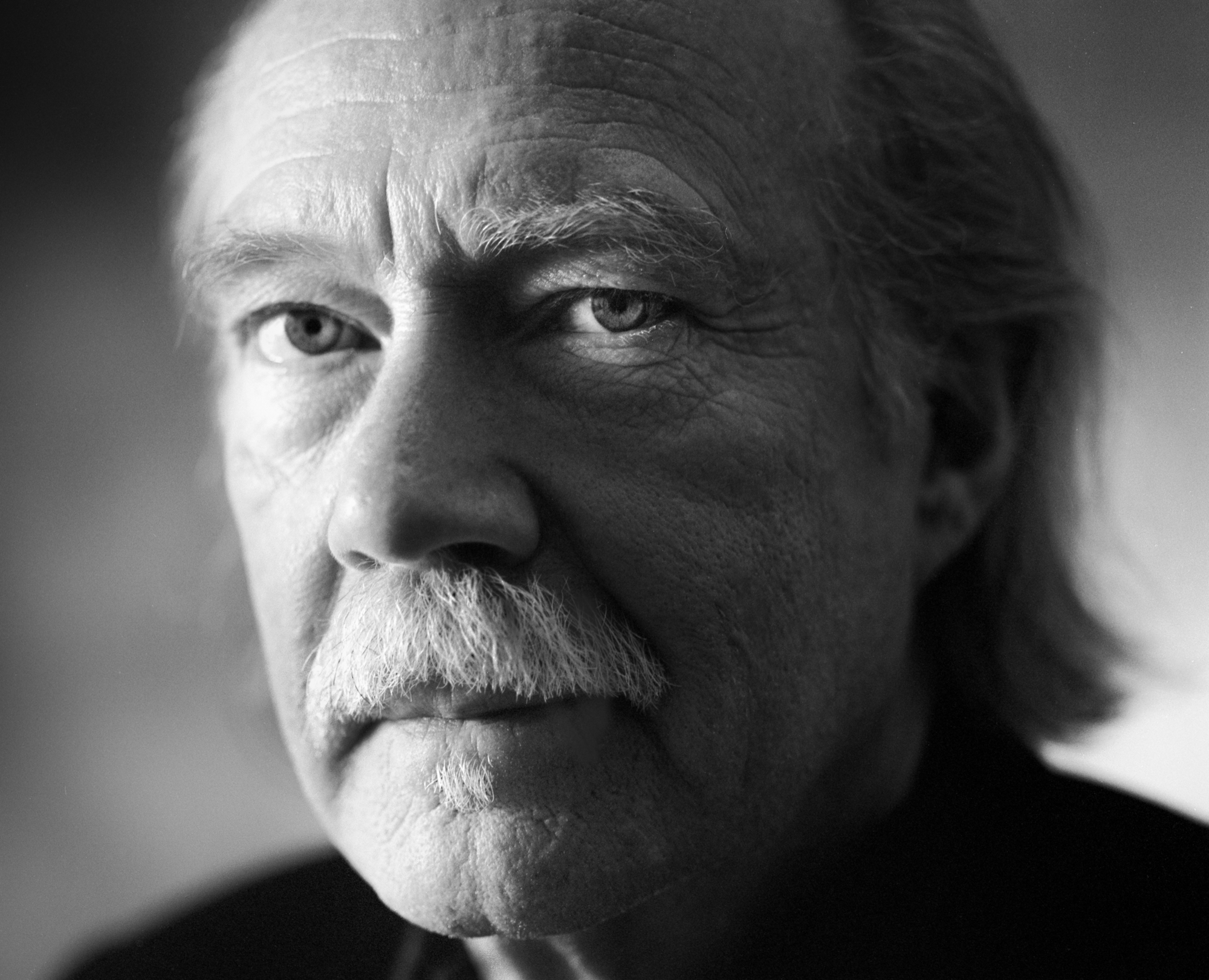Revolver Live! mit dem Kameramann Jürgen Jürges, im Rahmen der Diagonale Graz. Am 07.04.2024, 14 h. Mit Christoph Hochhäusler und Nicolas Wackerbarth.
Seit dem 1. Januar sind sie wieder für zwei Wochen zu sehen, die Unknown Pleasures, die Filme des Festivals für amerikanisches Independent Kino, das Hannes Brühwiler jedes Jahr aufs Neue so großartig zusammenstellt. Dieses Jahr wartet er im Arsenal am Potsdamer Platz mit einer besonders spannenden Retro auf, mit Filmen von Michael Roemer. Diese Filme passen in kein Raster, keine filmtheoretische Einordnung, zumindest keine mir bekannte. Das macht sie so schön.
Da gibt es beispielsweise einen Film von 1989, der allein schon die Reise an den unwirtlichen Potsdamer Platz wert ist, weil er vor Überraschungen, vor Wärme und Energie und vor Witz nur so strotzt: The Plot Against Harry. Martin Priest spielt Harry, einen Halbweltkönig, dem die Felle davon schwimmen – inmitten von Mafiakomplotts, Modeschauen, Bar Mizwas, Unternehmensgründungen, Hochzeiten, Hundeshows und der Begegnung mit seinen erwachsenen Töchtern, von deren Existenz er vorher nichts wusste. Erst taucht eine auf, mitsamt Enkelin und deren Bräutigam, dann kurz darauf noch eine zweite jüngere, die das, was eins heute so leichtfertig eine toxische Beziehung nennt, führt. Eigentlich ist all das – strukturell und inzwischen auch inhaltlich – im Film verboten, aber bei Roemer ist es lebendig, und er kann es auch inszenieren.
Harrys stoisches Lächeln, seine liebevoll kriminelle Hilfs- und Opferbereitschaft, seine hartnäckige Weigerung, an seinem Abstieg zu verzweifeln, die gab es schon mal: Ben Gazarras Cosmo in Killing of a Chinese Bookie. Wenn nicht Roemer und Priest diese Figur sieben Jahre vor Cassavetes und Gazarra erfunden hätten. Denn The Plot Against Harry wurde schon 1969 gedreht. Nur kam der Film nach seiner Fertigstellung nicht heraus. Weil niemand ihn lustig oder auch nur interessant fand. Der Film verschwand einfach. Zwanzig Jahre später wollte Roemer seinen Kindern sein filmisches Schaffen auf VHS schenken und hat auch The Plot Against Harry überspielen lassen. Der Techniker, der die Überspielung machte, musste lachen, als er den Film parallel zum Ausspiel sah, und das wiederum hat Roemer dazu verleitet, doch noch zwei 35 mm Kopien anfertigen zu lassen. Und auf einmal lief der Film international auf Festivals und war auch in den amerikanischen Kinos und bei der Kritik erfolgreich. Ein Märchen, ein über 20 Jahre trauriges, aber am Ende glückliches. Man möchte gar nicht darüber nachdenken, wie viele bis zum Ende unglückliche es gibt.
Auf das glückliche Ende eines anderen Märchens hoffe ich noch: dass das Arsenal, das kommunale Kino Berlins, wo ich diesen schönen Film gesehen habe und wo er diese Woche auch noch einmal zu sehen ist, nicht die unwirtliche Mitte der Stadt verlässt. Auch wenn das Silent Green möglicherweise der hippere Ort ist als das freudlose lochmetallene Tiefparterre des Sony Centers mit seiner rotgelbblauen Deko, die an postmoderne Bushaltestellen erinnert, liegt das Kino am Potsdamer Platz doch so, dass die meisten Menschen der Stadt es gut erreichen können.
Der Umzug an einen Ort außerhalb des S-Bahnrings ist stadtpolitisch ein höchst problematisches Signal. Es ist eben nicht nur ein Umzug, sondern auch ein Rückzug und berührt die Frage: Wem überlassen wir die Stadt?
Eine demokratische Gemeinschaft sollte nicht zulassen, dass sich gemeinwohlorientierte Einrichtungen zurückziehen in die Peripherie. Weil die Mitte der Stadt, so hässlich sie ist, eben erreichbarer ist oder anders ausgedrückt: für mehr Menschen schneller zugänglich. Und die Zeit, die es dauert, an einen gemeinsamen Ort zu kommen, spielt eine Rolle. Vor allem für Menschen mit geringerem Einkommen und Vermögen.
Für Menschen aus Neukölln oder Kreuzberg oder Schöneberg oder Tempelhof oder Wilmersdorf oder Charlottenburg beispielsweise, Stadtteilen, aus denen viele Arsenalzuschauer*innen kommen, ist das geplante Kino im Wedding nur noch schwerlich mit dem Fahrrad erreichbar, und mit dem öffentlichen Nahverkehr dauert es wesentlich länger. Auch wenn der neue Standort für einige das Arsenal näher rücken wird, werden insgesamt weniger Menschen in den Genuss des Programms kommen. Viele werden gar nicht mehr kommen. Anscheinend wird genau damit auch gerechnet, denn der Kinoneubau hat im dann einzigen Saal weniger Plätze als der große Saal der zwei aktuellen Säle. Auch das ein doppelter Rückzug. Weniger Plätze heißt weniger Gemeinschaft. Nur ein Saal heißt weniger Programm.
Warum überhaupt ein Kino neu bauen, wenn es innerhalb des S-Bahn Rings einige Kinos gibt, die geschlossen wurden in den letzten Jahren. Mit Bestuhlung, mit Notausgängen, mit Vorhang, mit Lüftung, mit Leinwand, mit Geschichte?
Dafür kann es Gründe geben, aber die demokratische Frage bleibt: Warum wird so ein Umzug nicht öffentlich diskutiert? Bei einer Einrichtung wie einem kommunalen Kino müssten doch neben den Leiter*innen der Einrichtung auch die Angestellten, die Mitglieder, die Filmemacher*innen, deren Filme dort laufen, aber vor allem die, für die es da ist, die Bürger*innen einer Stadt, die ins Kino gehen, mitreden, ja sogar mitbestimmen dürfen, wohin der Umzug geht.
Vielleicht ist er ja noch aufzuhalten:
The Plot Against the Arsenal
Franz