Revolver Live! mit dem Kameramann Jürgen Jürges, im Rahmen der Diagonale Graz. Am 07.04.2024, 14 h. Mit Christoph Hochhäusler und Nicolas Wackerbarth.
Film und Fernsehen haben in Deutschland ein ehe-ähnliches Verhältnis. Dietrich Leder hat einen kurzen Abriss dieser wechselvollen Beziehungsgeschichte geschrieben (für die Blackbox, s.u.), den jeder gelesen haben sollte, der verstehen möchte, welche Teile im Räderwerk des deutschen Films beweglich waren oder sind. Einsprüche, Kommentare, Anregungen sind wie immer willkommen.
C.H.
—
 |
| „Bioelectronical addiction“: Cronenbergs VIDEODROME (Kanada 1983). |
Vorweg
Freundlich ist die Stimmung nicht, in der nicht nur in der „Blackbox“ über die Beteiligung von Fernsehanstalten an der deutschen Filmförderung diskutiert wird. Neben einer gewissen Schmäh-Rhetorik fällt das Fehlen jedweder historischen Reflexion auf. Wie es kam, dass es so ist, wie es nun beklagt oder verteidigt wird, interessiert keinen. Stattdessen behauptet jeder zu wissen, wie man es besser machen könnte, bar jeder historischen Erkenntnis. Deshalb ein Blick zurück in die schwierige Partnerschaft zwischen Fernsehen und Kino in Deutschland.
Die frühen Jahre (1954 – 1966): Das Fernsehen entdeckt den Kinofilm
Bereits im Versuchsprogramm der Nazis, das zwischen 1936 und 1939 in den Fernsehstuben von Berlin zu sehen war, wurden Kinofilme in Ausschnitten gezeigt. Der Unterschied zwischen der Rezeption in einer Fernsehstube und einem Kino lag allein in der Differenz der Bildgröße und –qualität. Die Öffentlichkeitsform war dieselbe. Noch die ersten populären Live-Übertragungen des Versuchsbetriebs eines nun demokratisch verfassten Fernsehens nach dem Krieg wurden kollektiv wahrgenommen. Die Übertragung der Krönung der englischen Königin 1953 und das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 1954 sahen die meisten Zuschauer in Kneipen, vor Fernsehgeschäften und in Kinos. Erst mit dem Start des regulären Programmbetriebs des von der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands (ARD) betriebenen Deutschen Fernsehens im November 1954 und mit der stark wachsenden Zahl der Geräte wurde der Fernsehkonsum privat.
Eine Folge des neuen Fernsehkonsums (und der Automobilisierung der Gesellschaft) war der Rückgang der Besucherzahlen im Kino. 1957, als die Zahl der angemeldeten Geräte erstmals die Millionengrenze überstieg, gingen die Bundesbürger durchschnittlich 15,1 Mal im Jahr ins Kino. Diese Zahl sollte Jahr für Jahr dramatisch sinken, ehe sie sich Ende der 1970er-Jahre auf einem sehr niedrigen Sockel von 2 Besuchen pro Jahr stabilisierte; um diesen Wert pendelt sie seitdem. Da gleichzeitig die Zahl der in Deutschland produzierten Filme stabil blieb (1958: 115 Film, 2008: 125) und der Marktanteil dieser deutschen Filme nicht stieg, bedeutet das, dass die deutsche Filmproduktion seit Ende der 1950er-Jahre extrem defizitär wirtschaftet. Dieses Defizit, das aus mangelnden Einnahmen an der Kinokasse resultiert, wird bis heute durch staatliche Förderungen und durch das Fernsehen abgedeckt. Mit einer doppelten Folge: Kinofilmproduktion in Deutschland ist eine vom Fernsehen abhängige Subventionswirtschaft. Und: In Deutschland verdient der Produzent nicht am Verkauf seines Produkts, sondern nur am Produzieren selbst.
Der enorme Rückgang der Zuschauerzahlen im Kino hatte seine Ursache aber nicht darin, dass das Fernsehen in den späten 1950er-Jahren vor allem Kinofilme zeigte. Im Gegenteil, außer einigen Ufa-Melodramen der Nazizeit, mit denen man einmal pro Woche das Programm stopfte, wurden keine Spielfilme ausgestrahlt. Auch eine Folge der Blockade, die von deutschen Produzenten gegenüber dem Fernsehen ausgesprochen worden war: „Kein Meter Film fürs Fernsehen!“ hieß 1955 die Parole eines einflussreichen Produzenten. Davon profitierte ein Zwischenhändler, der auf eigenes Risiko Filmrechte erwarb und zunächst an die ARD und später vor allem an das 1963 startende ZDF veräußerte: Leo Kirch. Während die ARD sich bald von Kirch unabhängig machte und mit der Degeto eine Produktions- in eine Einkaufsfirma umwidmete (Ende der 1990er-Jahre wurde das revidiert), blieb das ZDF lange von Kirch abhängig, der phasenweise mit fast allen major companies Exklusivverträge abgeschlossen hatte.
Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) zeigte vom Start an mehr Spielfilme als bislang die ARD und war damit erfolgreich. Prompt zog das Erste Programm nach. Doch der Wettbewerb zwischen beiden Sendern fand auch auf inhaltlicher Ebene statt. Die zuständigen Redaktionen überboten sich geradezu darin, in Reihen wie „Das Film-Festival“ (ARD) oder „Der Besondere Film“ (ZDF) zur besten Senderzeit den Fernsehzuschauern Spielfilme zu zeigen, die sie im Kino nicht oder nicht mehr zu sehen bekamen. Sie sorgten so für eine filmgeschichtliche Bildung in Deutschland, wie sie von den Kinos schon lange nicht mehr erbracht werden konnte.
Der Junge Deutsche Film (1966 – 1974): Vom Kino ins Fernsehen
Der Junge deutsche Film, der sich mit dem Oberhausener Manifest 1962 zu Wort gemeldet hatte und der 1966 mit ersten Spielfilmen wie „Abschied von gestern“ (Alexander Kluge), „Der junge Törless“ (Volker Schlöndorff) oder „Es“ (Ulrich Schamoni) im deutschen Kino für Furore sorgte, hatte zunächst mit dem Fernsehen nichts zu tun. Gefördert wurden diese ersten meist sehr preiswerten Filme einzig und allein vom „Kuratorium Junger Deutscher Film“, das zunächst vom Bundesinnenministerium finanziert wurde und sich der Initiative der Oberhausener verdankte. In ihrem Manifest hatten sie deutlich auf den Doppelcharakter des Kinofilms abgehoben: Zum einen ist er eine Ware, zu deren Herstellung „wirtschaftliche Risiken“ gehören, die sie zu tragen bereit seien. Zum anderen ist er der Kunst zuzurechnen, die sich durch Autonomie, Experiment und eine eigene „neue Sprache“ auszeichne. Damit erhoben die Oberhausener als explizite Autorenfilmer in der Tradition der Nouvelle Vague indirekt Anspruch darauf, dass der Kinofilme wie andere Künste auch der Fürsorge staatlicher Einrichtungen bedurfte. Damit gerieten sie aber in ein staatsrechtliches Dilemma: In Deutschland ist die Kultur und ihre Förderung ausdrücklich Ländersache. Nur aus Gründen der Auslandsrepräsentation (Goethe-Institute) und die Lobpreisung von Spitzenleistungen (Bundesfilmpreis) darf der Bund in Kulturdingen aktiv werden.
Ende 1967 trat das Filmförderungsgesetz (FFG) in Kraft, das über die 1968 gegründete Filmförderungsanstalt (FFA) allein mittels einer Referenzförderung Produzenten finanziell stützte, die mit vorhergehenden Spielfilmen im Kino ein Verleihbruttoergebnis von mehr als umgerechnet 250.000 Euro (bei Prädikat 150.000 Euro) erwirtschaftet hatten. Finanziert wurde diese reine Wirtschaftsförderung durch eine Abgabe, die auf jede Kinokarte (auch für ausländische Filme) erhoben wurde. Dieses Verfahren, mit dem sich die FFA bis heute teilweise finanziert, ist strittig. Für den Kopf der Oberhausener Gruppe, Alexander Kluge, war die „quasi-fiskalische Abgabe“ nur dann rechtens, wenn ihre Erhebung und Verteilung im „Interesse der Allgemeinheit“ liege. Das FFG bevorzuge aber nur einige wenige Produzenten und angeschlossene Verleihe. Problematischer noch als das FFG war für die jungen Autorenfilmer, dass das Bundesinnenministerium parallel zur Gründung der FFA seine Zuschüsse an das Kuratorium zurückfuhr und die Finanzierung weitgehend den für die Kultur zuständigen Bundesländern überließ. Diese interessierten sich aber (noch) nicht sonderlich für die Filmförderung, so dass das Kuratorium an Bedeutung verlor. Da die zweiten Spielfilmen von Kluge, Schlöndorff, Schamoni und Co. an der Kinokasse bei weitem nicht so erfolgreich wie die ersten waren und folglich keine Referenzmittel der FFA erwirtschafteten, geriet der Junge deutsche Film schon ins Stocken, noch ehe er so richtig begonnen hatte.
Vor allem die nächste Generation von Regisseuren hatte Mühe, ihre ersten langen Filme zu finanzieren. Als ihre Partner sprangen die Fernsehspielredaktionen von ARD und ZDF ein. In den frühen Jahren des bundesdeutschen Fernsehens verstand man unter dem Fernsehspiel meist live im Studio produzierte Fassungen von Bühnenwerken aller Art. Unter Egon Monk im Norddeutschen Rundfunk (NDR) ab 1960 und unter Günter Rohrbach im Westdeutschen Rundfunk (WDR) ab 1966 wurden die Fernsehspiele filmischer und ähnelten sich von Erzählweise, Bildsprache und Besetzung immer stärker einem Kinofilm an, den es zu dieser Zeit im deutschen Kino nicht oder kaum mehr gab. Rainer Werner Fassbinder drehte in kürzester Zeit zwischen 1970 und 1972 neben einigen reinen Kinofilmen für den WDR „Das Kaffeehaus“ und „Die Niklashauser Fahrt“, für das ZDF „Pioniere in Ingolstadt“, für den Sender Freies Berlin (SFB) „Wildwechsel“ und dann wieder für den WDR der Fernsehmehrteiler „Acht Stunden sind kein Tag“ (Redakteur: Peter Märtesheimer). Wim Wenders realisierte alle seine frühen Spielfilme zusammen mit der Fernsehspielredaktion des WDR (Joachim von Mengershausen). Werner Herzog produzierte seinen ersten großen Kinofilm „Aguirre, der Zorn Gottes“ zusammen mit dem Hessischen Rundfunk (HR), der sich auch an den Filmen von Danielle Huillet und Jean-Marie Straub beteiligte. Alexander Kluge realisierte zusammen mit dem Kleinen Fernsehspiel (ZDF), das unter Leitung von Eckart Stein zu einer Anlaufstelle der jüngeren Filmregisseure wurde, „In Gefahr und Größter Not ist der Mittelweg der Tod“. Für diese Redaktion (Anne Even) entstanden beispielsweise auch die frühen Filme von Werner Schroeter.
Die gute alte Zeit (1974 – 1979): Die Allianz von Kino und Fernsehen
Es war diese Allianz aus den Regisseuren des Jungen Deutschen Film und den Fernsehspielredakteuren von ARD und ZDF, die den ambitionierten Kinospielfilm in Deutschland überleben ließ. Das Fernsehen wurde so zu einem Fluchtort vor einem Kino, das sich auch dank der FFA zunehmend trivialisiert und serialisiert hatte („Schulmädchenreport“), und das sich fatalerweise eine Strategie der Aufteilung und Aufsplitterung in immer kleinere Schachtelkinos hatte aufschwatzen lassen. Dieser von der Filmkritik unterstützten Allianz gelang es 1974, das FFG durch den Bundestag so novellieren zu lassen, dass neben die ökonomische Kategorie des Kassenerfolgs erstmalig auch eine qualitative trat; in der neuen Projektförderung wurden geplante Kinofilme nach Ausweis der eingereichten Unterlagen (Drehbuch, Besetzung, Finanzierungsplan) qualitativ durch eine Vergabekommission geprüft und ausgewählt. Gleichzeitig wurde die Einnahme-Hürde der Referenzfilmförderung niedriger gestellt.
Schließlich schlossen ARD und ZDF mit der Filmwirtschaft ein Film-Fernsehen-Rahmenabkommen, nach dem die Sender zusätzlich Mittel für die Projektförderung der FFA zur Verfügung stellen. Den bis heute so geförderten Filmen wird eine Abspielzeit im Kino eingeräumt; erst danach darf die beteiligte Fernsehanstalt die Filme ausstrahlen. (Zuvor schloss das FFG Filme aus der Referenzförderung aus, wenn sie vor einer Frist von fünf Jahren im Fernsehen gezeigt worden waren!) ARD und ZDF haben seitdem jährlich zwischen umgerechnet 4,4 (1974) und 15,6 Millionen Euro (2010) zur Förderung von Kinospielfilmen beigesteuert. Und bei aller Kritik an Einzelentscheidungen kann sich die Liste dieser Produktionen sehen lassen.
Einer der ersten Filme, die nach dem Rahmenabkommen entstanden, war Schlöndorffs „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, der im Kino sehr erfolgreich war und auch drei Jahre nach dem Verleihstart im Fernsehen für hohe Aufmerksamkeit sorgte. Weitere Filme von Hans W. Geißendörfer, Helma Sanders-Brahms, Margarethe von Trotta und vielen anderen folgten und sorgten international für Aufmerksamkeit. Mit der Folge, dass Herzog und Wenders nach Hollywood gingen. Höhepunkt des Erfolgs war der Oscar für „Die Blechtrommel“, Schlöndorffs Verfilmung des Grass-Romans. Im In- wie im Ausland stand der einst junge deutsche Film im Zenit.
Doch die strategische Allianz, die den Autorenfilmern einen Ausweg aus der ökonomischen Sackgasse eines krisengeschüttelten Kinomarktes mit Konkursen von Produktionsfirmen, Verleihen wie Atlas oder Gloria und Schließungen vieler Lichtspieltheater in Kleinstädten und den Vororten wiesen, sollte nicht lange halten. Die ersten Risse in der Allianz waren vor allem den gesellschaftlichen Verhältnissen geschuldet. Der Terror der RAF hatte 1977 die Bundesrepublik in den Grundfesten erschüttert. Das hatte zum einen in den Fernsehanstalten, die nicht der Sympathie mit dem Terror geziehen werden wollten, zu einer gewissen Ängstlichkeit geführt, was die Autorenfilmer zurecht (erinnert sei an die Sequenz von Schlöndorff im Kinofilm „Deutschland im Herbst“) kritisierten. Das hatte zum anderen aber auch bei vielen Regisseuren den Abschied von einem realistischen Gegenwartskino provoziert, dem sie nun Verfilmungen von Literatur des 19. Jahrhunderts entgegenstellten. Diese gediegenen und braven Filme wirkten wie der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich Kino und Fernsehen in der Vergabekommission verständigen konnten. Ein ästhetischer und thematischer Kompromiss, für den sich niemand interessierte – im Kino wie im Fernsehen.
Die Periode des Umbruchs (1979 – 1992): Entdeckung der Ränder und der neuen Märkte
Alexander Kluge, der das Rahmenabkommen mit Ungureit und Rohrbach auf den Weg gebracht hatte, wagte 1979 eine neue Initiative, als er in Hamburg die erste kulturelle Länderfilmförderung anstieß. Er wollte den großen Förderungen der FFA incl. des Rahmenabkommens eine kleinere entgegenstellen, die sich verstärkt um den Nachwuchs, um die weitgehend ignorierten Regisseurinnen, um den Dokumentar- und Experimentalfilm kümmern sollte. Diese explizit künstlerische Förderung wurde in Selbstverwaltung betrieben. Zu diesem Zweck gründeten Filmemacher erst in Hamburg, dann auch in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Berlin Filmbüros, welche die von den jeweiligen Kultusressorts der Länderregierungen bereit gestellten Mittel an Projekte vergab. Um dem Vorwurf der Selbstbedienung zu entgehen, sollten die Gremien nicht auf Dauer besetzt, sondern entweder permanent oder nach einer streng bemessenen Zeit neu besetzt werden. Prinzip: Rotation.
Mitte der 1980er-Jahre wurde so das Filmförderklima von den Rändern vitalisiert. Gleichzeitig hatte es sich in seinem Zentrum verändert. Günter Rohrbach, der 1980 zur Bavaria nach München gewechselt war, hatte mit dem neuen Job seine Strategie geändert. Als Chef einer Produktionsfirma, die zu weiten Teilen Fernsehsendern wie dem WDR gehörte, setzte er jetzt auf teure Produktionen wie „Die unendliche Geschichte“ oder „Das Boot“, mit denen er auch jenseits des deutschen Kinomarktes erfolgreich sein wollte. Ähnliches betrieb Bernd Eichinger, der an der „Unendlichen Geschichte“ beteiligt war und der mit dem Film „Der Name der Rose“ eine von Deutschland ausgehende internationale Koproduktion angestoßen hatte, die weltweit erfolgreich war. Eichinger, dessen Produktionsfirma Constantin offiziell lange als unabhängig galt, während sie mindestens zur Hälfte heimlich Leo Kirch gehörte, propagierte wie Rohrbach die Idee eines teuren, bildersatten Kinofilms, der sich auch international verkaufen ließ.
ARD und ZDF war zu dieser Zeit eine ungewohnte Konkurrenz erwachsen. 1984 bzw. 1985 starteten die ersten deutschen Privatsender, die potentiell Partner auch für Kinofilme werden konnten. Aus der Filmszene hatte sich nur Alexander Kluge mit dieser Entwicklung beschäftigt. In seiner letzten medienpolitischen Initiative legte er 1988 kommerziellen Sendern wie RTL und Sat1 die Pflicht auf, unabhängige Kultursendungen zuzulassen. Diese produzierte Kluge mit der von ihm und dem japanischen Werbefirma Dentsu gegründeten DCTP, zu deren Gesellschafter später der Spiegel-Verlag hinzukam. Kluge hatte sein Kulturangebot als Repräsentant auch der Autorenfilmer lanciert; die Sendungen produzierte er aber weitgehend allein. Bis heute.
Gleichzeitig hatte der Kinofilm über die Videokassette einen neuen Absatzmarkt hinzugewonnen. 1984 gab es in den deutschen Haushalten schon über fünf Millionen Videorecorder, mit denen die Besitzer nicht nur das laufende Fernsehprogramm mitschneiden, sondern auch Leih- und Kaufkassetten abspielen konnten. Über Videotheken wurde das Leihgeschäft abgewickelt, das sich in der Verwertungskette zwischen Kinoabspiel und Fernsehverkauf schob. Erst um das Jahr 2000 ging das Geschäft mit den Videokassetten zurück, als ihr die technisch bessere DVD erhebliche Konkurrenz den Rang ablief. Ein Geschäft, das erst in den letzten Jahren wegen der im Internet zugänglichen Filme an Marktmacht verlor.
Die Jahre der Hausse (1992 – 2002): Goldgräberstimmung auf allen Äckern
1992 schrieb der von Luxemburg nach Köln umgezogene Sender RTL, an dem sich der Bertelsmann-Konzern beteiligt hatte, erstmals schwarze Zahlen. Fernsehen erwies sich endlich als das große Geschäft, von dem viele einst gesprochen hatten. Die Nachricht des Erfolgs löste eine Neuorientierung der bisherigen Medienpolitik aus. War sie bislang auf die Sicherung von Vielfalt ausgerichtet, wurde sie jetzt als ein Instrument der Wirtschaftspolitik begriffen. Vorreiter war das damals sozialdemokratisch regierte Nordrhein-Westfalen, das nun mittels der Medienpolitik den Wirtschaftsstandort stärken und so beispielsweise den im Land angesiedelten Bertelsmann-Konzern stützen wollte. Die Medienproduktion sollte langfristig den Verlust der Schwerindustrie kompensieren, unter dem Nordrhein-Westfalen zunehmend litt.
Eine Folge der neuen Politik war die Gründung der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, die an der Seite der kulturellen Förderung durch das Filmbüro nun die Filmproduktion im Land wirtschaftlich ankurbeln sollte. Zu ihrer Finanzierung hatte man sich etwas Besonderes ausgedacht: Neben den Geldern, die aus dem Haushalt des Wirtschaftsministerium kamen, sollten Mittel treten, die von der Düsseldorfer Landesmedienanstalt (LfM) nicht verbraucht worden waren. Sie war 1987 parallel zu vergleichbaren Institutionen in den anderen Bundesländern gegründet worden, um den privaten Rundfunk (Fernsehen und Radio) zu kontrollieren. Zu der Finanzierung dieser Kontrolle war die Rundfunkgebühr erhöht worden. Überschüssige Mittel sollten nach dem Rundfunkstaatsvertrag an die Landesrundfunkanstalten zurückfließen. Diese Mittel leitete die Landesregierung nun in die Filmstiftung um.
Damit die zuständige Landesrundfunkanstalt nicht gegen diese Umleitung und Umwidmung klagte, lud die Landesregierung den WDR ein, nicht nur Gesellschafter der Filmstiftung zu werden, sondern auch Vertreter in das Vergabegremium zu entsenden. Nach diesem Modell finanzieren sich mittlerweile alle anderen Institutionen, die der Filmstiftung in den anderen Bundesländern nachgebildet wurden: das Filmboard Berlin (1994), das zehn Jahre später mit dem Medienbüro von Brandenburg zum Medienboard erweitert wurde, die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (1995), die Filmförderung Hamburg (1994), die einige Jahre später mit der von Schleswig-Holstein fusionierte und nun als Filmförderung HSH firmiert, der FilmFernsehFonds Bayern (1996), die Mitteldeutsche Medienförderung (1998) und die niedersächsische Nordmedia (2000). Und da bis heute in all diesen Einrichtungen die Überschussmittel der jeweiligen Landesmedienanstalt zur Filmförderung eingesetzt werden, bestimmen überall dort auch die jeweiligen Landesrundfunkanstalten mit.
In Zeiten knapper öffentlicher Kassen reduzierte die nordrhein-westfälische Landesregierung ihren Finanzanteil an der Filmstiftung. Um das zu kompensieren, lud man erst das ZDF, dann RTL ein, sich mit Geldern am zu verteilenden Fördertopf zu beteiligen. Diese nahmen das Angebot selbstverständlich in der Hoffnung an, dass sie wie der WDR gleichsam das investierte Kapital zuzüglich Zinsen als Förderung ihrer Projekte auch wieder ausgezahlt bekämen. Eine Rechnung, die für das Land (150 Prozent der Fördersumme muss in Nordrhein-Westfalen ausgegeben werden) wie für die Sender aufgeht. Und die zugleich die Binnenstruktur in dem Vergabegremium veränderte, dem nun gleich drei Sendervertreter (WDR, ZDF, RTL) angehören. Der Fernseheinfluss ist damit strukturell festgeschrieben.
Mitte der 1990er-Jahre begannen die privaten Sender aus Konkurrenzgründen verstärkt in deutsche Fernsehfilme und –serien zu investieren. So versuchten sie, bekannte Schauspieler an sich zu binden, für die sie Reihen und Bouquets von Einzelfilmen zusammenstellten, was die Honorare für die Stars beträchtlich ansteigen ließ. Ende der 1990er-Jahre entstanden so über 300 Fernsehfilme. Die Branche boomte, und die Frage, ob man nun für das Kino oder für das Fernsehen arbeitete, stellte sich nicht. So geriet außer Blick, dass sich die Lage für die Kinos wirtschaftlich verschlechtert hatte. Multiplexe nahmen den traditionellen Erstaufführungskinos erst die Filme, dann die Zuschauer weg. Kinoketten wurden als Spekulationsgut gekauft und wieder abgestoßen. Innenstadtkinos konnten die steigenden Mietpreise nicht mehr zahlen. Die Zahl der Kopien bei Massenstarts stieg überproportional zur Zahl der Leinwände weiter an, was die Startchancen für kleinere Spielfilme reduzierte.
Auch für ARD und ZDF stellte sich die Lage nicht rosig dar. Sie verloren massiv Zuschauer an die private Konkurrenz. Die Folge war eine gewisse Panik, mit der man in den öffentlich-rechtlichen Programmen das eigene Angebot musterte. Ambitionierte Sendungen, zu denen das Spielfilmangebot in der Tradition der Filmkultur gehörte, wurden in die Nacht verbannt oder in die Kultursender Arte und 3sat ausgesiedelt. Die Dritten Programmen mutierten zu Regionalsendern mit einem hohen Unterhaltungs- und Wiederholungsanteil. Programmmarken wie der „Tatort“ in der ARD und die „Soko 5113“ im ZDF wurden ausgeweitet, variiert und permanent wiederholt. Auch die Fernsehspieltermine im Hauptabend wurden auf ihre Publikumstauglichkeit überprüft; erinnert sei an die Süßstoffdebatte der ARD. Der starre Blick auf die absoluten Einschaltzahlen und die relationale Quote ersetzte die Orientierung auf Qualität und Konzept, die zuvor weite Teile des Programms bestimmt hatte. Eine Folge: Die im Rahmenabkommen entstandenen Kinofilme durften nur im Ausnahmefall auf den Sendeterminen der Fernsehspiele laufen, im Normalfall wurden sie an den Programmrand verpflanzt, wo sie keiner mehr so richtig wahrnahm, was die Identifikation mit solchen Produktionen in den Sendern weiter abnehmen ließ.
Die Jahre der Baisse (2002 – 2011): Die Krise provoziert die Debatte
2002 ging der Kirch-Konzern Konkurs; er hatte sich mit teuren Kinospielfilm- und Sportrechten für seinen Pay-TV-Sender Premiere verschuldet. Damit gerieten nicht nur die Sender des Konzerns in die Krise, sondern auch dessen Produktionsfirmen. Aus dem Konzern herausgelöst mussten die Sender drastisch sparen – vor allem auch an den Auftragsproduktionen an Einzelfilmen und Serien. Da gleichzeitig sich auch der Bertelsmann-Konzern verschuldet und seiner Cashcow RTL die Hauptlast der Tilgung auferlegt hatte, musste auch dieser Sender drastisch sparen. Prompt halbierte sich die Zahl der Fernsehfilme pro Jahr und nahm die Zahl der deutschen Serien stark ab.
ARD und ZDF konnten das nicht kompensieren. Im Gegenteil. Ihre Programmetats wurden durch teure Sportrechte so strapaziert, wie das Programm durch tägliche ausgestrahlte Talkshows stark eingezwängt wurde. Zudem imitierten ARD und ZDF die Strategie der privaten Sender, um Aufmerksamkeit für ihre fiktionalen Programme zu erzeugen, teure Zweiteiler produzieren zu lassen, die sie massiv bewarben und prominent platzierten. Dieses Event-Fernsehen band sehr viel Kapital, auch der Landesfilmförderungen, die zur Teilfinanzierung herangezogen wurden. Für die Kosten dieser Zweiteiler hätte man bis zu zehn einzelne Kino- und Fernsehfilme realisieren können.
Selbst die Länderfilmförderungen gerieten in eine Krise. Ausgelöst wurde sie durch die Europäische Union (EU), die darüber wacht, dass es in den Mitgliedsländern nicht zur Subventionierung von Branchen kommt. Um dem Verdacht zu entgehen, sie frönten reinen Standort- und damit Wirtschaftsinteressen wurden deshalb sukzessive die bislang noch autonomen kulturellen Förderungen in die jeweilige Länderförderung integriert, etwa 2002 in Nordrhein-Westfalen. Kinofilmförderung ist nur noch eine ihrer vielen Aufgaben; das kann man beklagen, aber es spiegelt nur die Machtverhältnisse wider; der Kinobruttoumsatz macht nur noch einen verschwindenden Bruchteil dessen aus, was im Fernsehgeschäft umgesetzt wird.
All das hatte für die Produzenten ökonomische Folgen: Nach einigen Insolvenzen nimmt der Monopolisierungsprozess unter den Produzenten zu. Bertelsmann-Töchter und die zu den öffentlich-rechtlichen Anstalten zählenden Firmen Bavaria und Studio Hamburg kauften kleinere Firmen auf. Dieser Marktmacht, die sich auch durch eine gewisse Nähe zu den von den Sendern mitbestimmten Förderungen auszeichnet, schüchtert kleinere Produzenten ein. Und in den Kinos bieten sich immer mehr deutsche Filme immer mehr Konkurrenz – um eine sinkende Zahl von (Arthouse-)Kinos, um einen Platz auf den immer voller werdenden Startterminplan, um die Aufmerksamkeit einer ihre Diskursqualität verlierenden Filmkritik. Erste Proteste gegen den Einfluss der Sender in den Fördersystemen werden laut.
Am Ende
Wo ansetzen, um die Lage zu verbessern? Zunächst einmal klare Trennung von wirtschaftlicher und kultureller Förderung nach ihren Zwecken. Minimierung der schematischen Förderung (beispielsweise auf dem Vertriebssektor durch den Deutschen Filmförderfonds!). Systematische jährliche Bilanzierung aller Förderungen nach wirtschaftlichen wie kulturellen Effekten. Fluktuation in den Gremien – auch und vor allem bei den Vertretern von Sendern, Politik und Verbänden. Rückbesinnung auf eine film- und medienpolitische Phantasie, wie sie ein Alexander Kluge von 1962 bis 1988 an den Tag legte. Beginn einer offensiven Qualitätsdebatte um die öffentlich-rechtlichen Sender: Wie und wodurch unterscheiden sie sich von der privaten Konkurrenz? (Diese Debatte darf nicht nach Partialinteressen geführt werden, denen nach Dokumentarisches, egal in welcher Form, immer schon besser als alles andere, Fernseh- und Kinofilme besser als Serien seien etc.). Verzicht auf die Remythisierung des Kinos, das sich vom Fernsehen durch eine andere Öffentlichkeitsform unterscheidet, aber nicht unbedingt durch eine andere Ästhetik. Gleichzeitig ökonomische Stärkung des Kinos (auch in der Auseinandersetzung um ihre Digitalisierung) als besondere Öffentlichkeitsform und als vitaler innerstädtischer Treffpunkt. Film- und fernsehhistorische Bildung durch die Gründung von Filmplattformen im Internet, auf denen die historisch relevanten Filme der Öffentlichkeit zugänglich gehalten werden. Rückkehr zu einem Diskurs über die Qualität von Kino- und Fernsehfilmen!
Dietrich Leder
Erschienen in black box Nr. 218, Juni/Juli 2011.
Der filmpolitische Informationsdienst black box erscheint alle sechs
Wochen und kostet 40 Euro (8 Ausgaben jährlich).
www.blackbox-filminfo.de
Danke: Ellen Wietstock.
Die blackbox kann man hier abonnieren.
(Eingestellt von Christoph)
Dieser Beitrag hat einen Kommentar
Kommentare sind geschlossen.
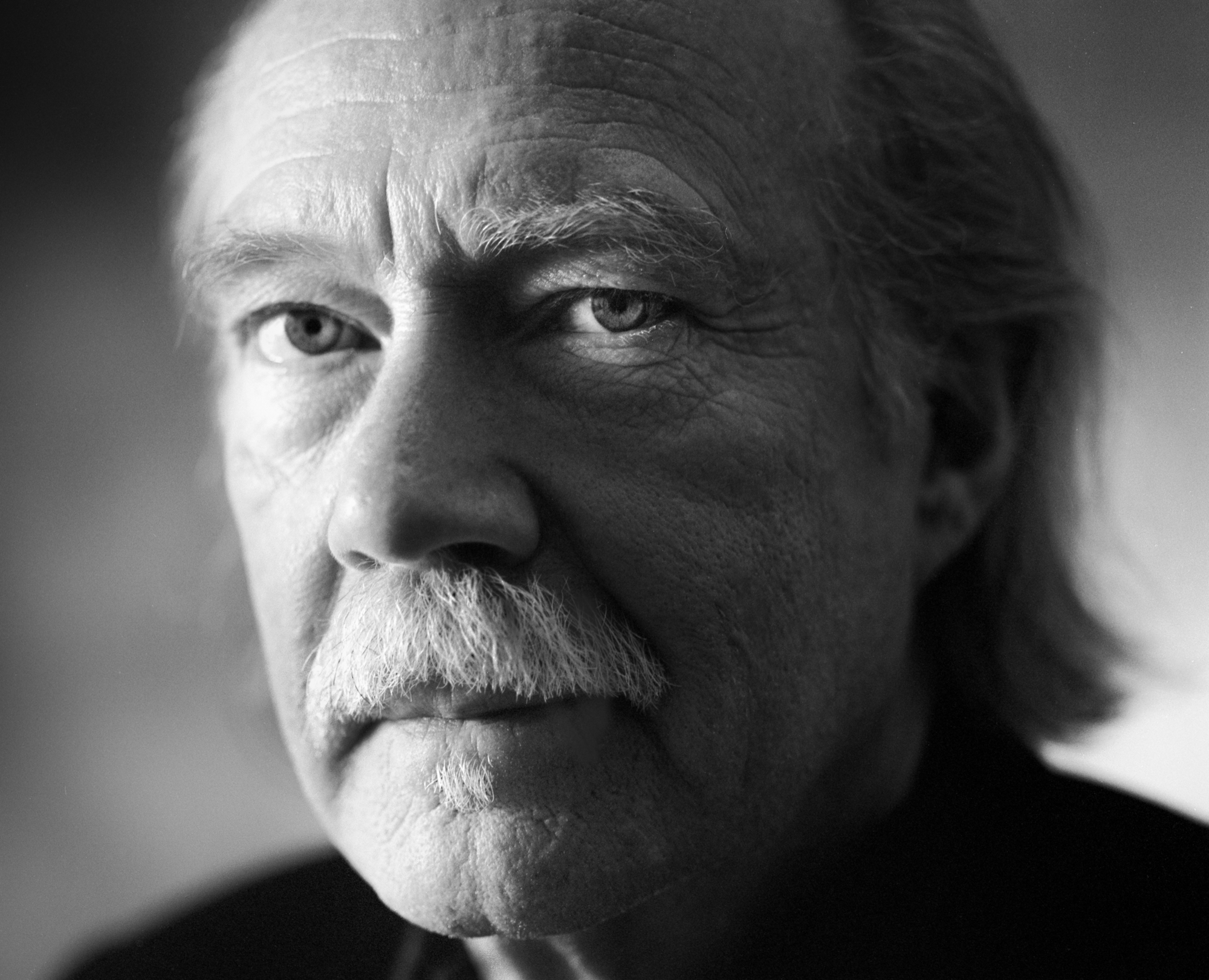


Sehr schöner "Schnelldurchlauf", der gut darstellt, dass sich die deutschen Filmproduzenten, soweit sie kulturelle Intentionen haben, seit Jahrzehnten in einem instabilen Umfeld bewegen. Man sieht: Wahrscheinlich hat das Konkubinat von Kino und Fernsehen summa summarum mehr ermöglicht als verhindert. Allerdings scheint irgendwann eine tektonische Verschiebung stattgefunden zu haben: die Diktatur der Quote. Der "Junge deutsche Film" war ja zu einem guten Teil legitimiert durch den Erfolg bei der Kritik. Dafür könnte sich heute niemand mehr etwas Förderung und Wohlwollen erkaufen. Heute scheinen immer mehr die Zuschauerzahlen auch die kulturelle Bedeutung, zumindest auch die kritische Wahrnehmung, mitzubestimmen. Sind sie hoch, kommt auch der "Spiegel" drauf zu sprechen. Insofern volle Zustimmung zu dem Punkt: "Beginn einer offensiven Qualitätsdebatte um die öffentlich-rechtlichen Sender: Wie und wodurch unterscheiden sie sich von der privaten Konkurrenz?" Ich würde sogar sagen, die Qualitätsdebatte kann auch ruhig die sogenannten Qualitätsmedien einbeziehen, wo im Zweifelsfall der hoch promotete Erfolgsfilm mehr Raum kriegt als der "kleine" Film, dessen Produzenten nicht mit der Absicht gestartet sind, möglichst hohe Zuschauerzahlen zu erwirtschaften, sondern die eine künstlerischen Absicht gefolgt sind.
Nur nebenbei: Dominik Graf, in meinen Augen einer der wenigen wirklich erwähnenswerten Spielfilmregisseure (und Produzenten), die wir in D haben, demonstriert ja schon seit geraumer Weile, wie groß er die Aussichten einschätzt, noch gut produzierte künstlerische Qualität fürs Kino zu produzieren …